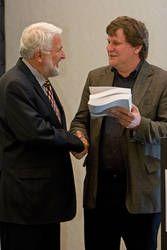14. Deutscher Psychotherapeutentag
Der 14. Deutsche Psychotherapeutentag (DPT) am 9. Mai 2009 in Berlin widmete sich der Zukunft der Ausbildung und begann mit der Positionierung der Psychotherapeuten für die nach der nächsten Bundestagswahl zu erwartende Gesundheitsreform.
Zentrale Ergebnisse des Forschungsgutachtens
Prof. Dr. Bernhard Strauß vom Universitätsklinikum Jena gab als Leiter der Forschergruppe dem Psychotherapeutentag einen Überblick über die zentralen Ergebnisse des Gutachtens. Er erinnerte daran, dass u. a. die Veränderung der Zugangsvoraussetzungen zur Ausbildung des Psychologischen Psychotherapeuten (PP) und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (KJP) durch die Einführung der europäischen Studienabschlüsse mit Bachelor-Master-Systematik Anlass des Gutachtens war. Nach Auslegung des Psychotherapeutengesetzes durch das BMG sei heute für die Ausbildung zum KJP bei Absolventen (sozial-)pädagogischer Studiengänge bereits ein Bachelorabschluss ausreichend, für Absolventen psychologischer Studiengänge setze die Aufnahme einer Psychotherapieausbildung (PP oder KJP) dagegen das Kompetenzniveau eines Masterabschlusses voraus. Darüber hinaus habe das Ministerium bei der Auftragsvergabe immer wieder vorgetragene Beschwerden zur Finanzierung der praktischen Tätigkeit (so genanntes Psychiatriejahr) und einzelne Reformvorschläge aufgegriffen. Generelles Ziel des Gutachtens sei aus BMG-Sicht eine Bestandsaufnahme der Ausbildungsbedingungen, -strukturen und -effekte zehn Jahre nach Einführung der Ausbildungsregelungen mit dem Psychotherapeutengesetz.
Dazu habe das Gutachten die aktuelle Ausbildungslandschaft in der Psychotherapie umfassend aufgearbeitet, Entwicklungen in der Psychotherapie im In- und Ausland dargestellt, Aussagen zu Inhalten und Ausgestaltung der alten und neuen pädagogischen und psychologischen Studiengänge getroffen, Vorschläge zu neuen inhaltlichen Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung zum PP und KJP gemacht, Möglichkeiten einer der ärztlichen Ausbildung vergleichbaren Direktausbildung geprüft und Empfehlungen dazu abgegeben, ob Psychotherapeuten zusätzliche Kompetenzen erhalten sollten, wie z. B. die Verordnung von Arzneimitteln.
Ausbildungsangebot und -qualität
Die Befragten äußerten im Durchschnitt eine mittlere Zufriedenheit mit Qualität und Angebot der Ausbildungsstätten. Ausbildungsteilnehmer wünschen sich mehr Kostentransparenz und niedrigere Kosten.
Verfahrensorientierung
Die Verfahrensorientierung der Ausbildung wurde von den Befragten vom Umfang her als angemessen eingeschätzt; auch der Anteil störungsspezifischen Wissens sollte so bleiben. Dagegen sollte der Anteil des verfahrensübergreifenden Wissens ebenso wie Grundkenntnisse anderer Vertiefungsverfahren nach Meinung der Befragten erhöht werden.
Praktische Tätigkeit
Die Befragten beurteilten die praktische Tätigkeit relativ negativ. Die Gründe sehen die Gutachter darin, dass etwa die Hälfte der Ausbildungsteilnehmer überhaupt keine Vergütung erhält und in vielen Einrichtungen ein nur sehr eingeschränktes Spektrum psychischer Störungen und entsprechender Behandlungen kennengelernt werden konnte.
Neue Studiengänge
Als Zugang zur Psychotherapieausbildung empfiehlt das Gutachten den Master als Studienabschluss. Alle Ausbildungsteilnehmer sollten nachweisen können, dass die Hälfte ihrer Hochschulausbildung allgemein-psychologische und klinisch-psychologische Inhalte umfasse, wobei ein Teil davon ggf. nach dem Studium im Rahmen eines "Propädeutikums" nachgeholt werden könne. Diese Zulassungsbedingung sollten künftig Masterabschlüsse in den Studiengängen Psychologie, Soziale Arbeit und (Heil-)pädagogik und ggf. wenigen weiteren Studiengängen erfüllen können.
"Ausbildung nach der Ausbildung" empfohlen
Die Befragten sprachen sich mehrheitlich für die Beibehaltung der postgradualen Ausbildung aus. Für eine Direktausbildung "sei die Zeit noch nicht reif", so Prof. Strauß. Um Weiterentwicklungen zu fördern, sollten integrierte Modellausbildungsgänge ("Direktausbildung") ermöglicht werden.
"Common trunk" für PP und KJP
Die Gutachter empfehlen, die Differenzierung zwischen Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und der Behandlung von Erwachsenen beizubehalten, allerdings das für beide Bereiche relevante Basiswissen in einem "common trunk" zu vermitteln. Auf diese Weise - so Strauß - könnten künftig Psychotherapeuten mit "Schwerpunkt Erwachsene" oder "Schwerpunkt Kinder und Jugendliche" gleichberechtigt ausgebildet werden bzw. eine Doppelapprobation erwerben.
Kompetenzen
Die Gutachtergruppe empfiehlt als Ergebnis intensiver Diskussionen eine begrenzte Erweiterung des Kompetenzprofils. Eine entsprechende Qualifizierung vorausgesetzt, sollten Psychotherapeuten in Zukunft die Arbeitsunfähigkeit bescheinigen, psychotherapierelevante Heil- und Hilfsmittel verschreiben und Patienten zu (Fach-)ärzten sowie zur stationären Heilbehandlung (in psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken) überweisen können. Allerdings sollen sie auch zukünftig nicht berechtigt sein, Psychopharmaka zu verordnen bzw. abzusetzen oder Zwangseinweisungen zu veranlassen.
Verkürzung der Ausbildung
Das Gutachten - so Strauß - empfehle eine Verkürzung der Ausbildung von 4.200 auf 3.400 Stunden. Dies könne durch Kürzung der praktischen Tätigkeit auf insgesamt 1.200 Stunden sowie eine deutliche Reduzierung der "Freien Spitze" erreicht werden. Parallel sollten - entsprechend der Voten der Ausbildungsteilnehmer - die Anteile der Einzelsupervision, der Selbsterfahrung und der praktischen Ausbildung etwas erhöht werden.
Zukunft der Psychotherapieausbildung: Position der Profession entwickeln
Prof. Richter regte angesichts der vorgestellten Ergebnisse des Gutachtens an, dass die Debatte in der Profession (siehe ausführlicher Bericht der BPtK im Psychotherapeutenjournal 2/2009) noch einmal an Fahrt gewinnen möge. Schließlich solle nach der Vorstellung der Gutachter nicht nur an der einen oder anderen kleinen Stellschraube gedreht werden. Es liege nun an der Profession, den sich aus den Daten ergebenden Änderungsbedarf selbst zu interpretieren und politische Schlussfolgerungen daraus zu ziehen.
Dafür könne und müsse sich die Profession die erforderliche Zeit nehmen. Der BPtK-Präsident warnte davor, sich schnell auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen. Es könne nicht alles so bleiben, wie es ist. Die Rahmenbedingungen psychotherapeutischen Handelns hätten sich in den vergangenen zehn Jahren gewandelt. Der Bolognaprozess habe eine Lawine von Veränderungen in der deutschen Hochschullandschaft losgetreten, die u. a. dazu geführt habe, dass Psychologiestudenten heute vier Semester länger studieren müssten als Studenten der Sozialen Arbeit, um zur Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zugelassen zu werden.
Entwicklung der Versorgung: Konsequenzen für die Profession
Auch die Versorgung psychisch kranker Menschen habe sich geändert. Stand der Wissenschaft sei heute, dass die meisten psychischen Erkrankungen durch Psychotherapie behandelt oder mitbehandelt werden sollten. Daher sei durch nichts mehr zu rechtfertigen, dass Psychotherapeuten in ihrer Ausbildung im Rahmen der praktischen Tätigkeit anderthalb Jahre lang bei der Behandlung jener wenigen Erkrankungen hospitieren sollen, bei denen Psychotherapie nicht indiziert sei.
Um dem Versorgungsbedarf psychisch kranker Menschen besser gerecht zu werden, müssten die Versorgungsstrukturen weiterentwickelt werden, stellte Prof. Richter in seinem Statement fest. Zu erwarten sei eine Flexibilisierung psychotherapeutischer Versorgungsangebote, eine geänderte Aufgabenverteilung zwischen den Gesundheitsberufen und ein stärkerer Fokus auf eine leitlinienbasierte, multiprofessionelle Kooperation in neuen Organisationsstrukturen.
Für Psychotherapeuten leitete er aus diesen Entwicklungen zwei Szenarien ab. Psychotherapeuten könnten bei unverändertem Kompetenz- und Tätigkeitsprofil zusehen, wie um sie herum neue Versorgungsstrukturen für psychisch kranke Menschen aufgebaut und etabliert werden, und sich auf die Richtlinienpsychotherapie konzentrieren, für die Psychotherapeuten heute überwiegend ausgebildet werden. Irgendwann könnte sich dann allerdings die Frage stellen, ob für den verbliebenen Versorgungsanteil der Psychotherapeuten überhaupt ein eigenständiger akademischer Heilberuf erforderlich sei.
Im zweiten Szenario werden Psychotherapeuten für die Übernahme umfassender Verantwortung für die Versorgung psychisch kranker Menschen und für Schlüsselfunktionen in neuen Versorgungsstrukturen qualifiziert. Der Anteil der Psychotherapeuten an der Versorgung psychisch kranker Menschen werde zunehmen. Ein eigenständiger akademischer Heilberuf sei bei diesem Aufgabenprofil mehr als gerechtfertigt. Auf dieses Aufgabenspektrum bereite die Ausbildung heute jedoch noch nicht ausreichend vor.
BPtK-Vorstandsmitglied Andrea Mrazek forderte, immer im Blick zu haben, um wessen Qualifikationen und Qualifizierung es gehe. In Abhängigkeit davon, ob man von Ausbildungsteilnehmern, frisch approbierten oder lange etablierten Psychotherapeuten spreche, werde man die Konsequenzen von Weiterentwicklungen der Versorgung für die Kompetenzen von Psychotherapeuten sehr unterschiedlich beurteilen.
Mrazek appellierte an den 14. DPT, in der Debatte um die Zukunft der Ausbildung auch tatsächlich die jungen Kollegen im Auge zu haben. Während Flexibilisieren der Versorgung für Etablierte eine Bedrohung darstellen könne, könne es dem Nachwuchs durchaus Chancen eröffnen und sollte unter diesem Gesichtspunkt weiter diskutiert werden.
Delegierte verwiesen darauf, dass die Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen bereits heute Spielräume in diesem Sinne lassen und einige Ausbildungsinstitute diese Möglichkeiten auch nutzten. Allerdings sei dies in der Praxis noch viel zu selten. Lösungen sahen Delegierte insbesondere darin, Inhalte und Dauer der praktischen Tätigkeit zu überdenken und durch angemessene Vorgaben die psychotherapeutische Versorgung in diesem Ausbildungsabschnitt besser abzubilden.
PP und KJP: Ein oder zwei Heilberufe?
BPtK-Vizepräsidentin Monika Konitzer und BPtK-Vorstandsmitglied Peter Lehndorfer skizzierten gemeinsam die Diskussion um ein oder zwei Heilberufe. Übereinstimmend stellten sie fest, dass sowohl PP als auch KJP Kinder, Jugendliche und Erwachsene versorgen und entsprechend der jeweiligen Schwerpunktsetzung dafür auch spezifische Kompetenzen brauchen. Sie schlugen für die Zukunft vor, ausgehend von einer breiten gemeinsamen Wissensbasis, die jeweils spezifischen Kompetenzen an Ausbildungsteilnehmer zu vermitteln. Generell sollten für beide Berufe wissenschaftliche und klinische Kenntnisse in qualifizierenden Studiengängen vermittelt werden, sodass sowohl Absolventen psychologischer als auch pädagogischer Studiengänge Zugang zur psychotherapeutischen Ausbildung erhalten.
In der Versorgung werden dann Psychotherapeuten ihre Kompetenzen vorrangig in die Behandlung von Kindern und Jugendlichen einbringen oder sich auf die Versorgung von Erwachsenen konzentrieren. Dabei sollte beiden Berufen eine Weiterqualifizierung möglich sein. Psychotherapeuten mit Spezialisierung für Kinder und Jugendliche sollten sich für die Behandlung Erwachsener weiterqualifizieren können und umgekehrt.
Eingewendet wurde von Delegierten, dass es schwierig sein könnte, diese Kompetenzprofile in einem vertretbaren Zeitraum zu vermitteln. Andere verbanden mit dem Modell die Chance, die eingeschliffenen KJP- und PP-Argumentationsmuster aufzulösen und einen neuen Blick für eine sachgerechte Gestaltung der Ausbildung von Psychotherapeuten zu gewinnen.
Welche Kompetenzen in welcher Phase?
BPtK-Vizepräsident Dr. Dietrich Munz verwies auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE (BT-Drs. 16/12401). Darin stelle das BMG fest, dass weder das Psychologiestudium noch die pädagogischen Studiengänge eine dem Medizinstudium vergleichbare Qualifikation zur Diagnose und Therapie psychischer Krankheiten vermittelten. Es sei, so das BMG, daher weder angemessen noch rechtlich zulässig, dass Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) im Rahmen der praktischen Tätigkeit unter Supervision eigenständig Behandlungen durchführen. Vielmehr diene die praktische Tätigkeit während der Ausbildung in erster Linie dem Kennenlernen der Krankheitsbilder, die einer psychotherapeutischen Behandlung nicht zugänglich seien.
Damit ignoriere das BMG den Stand der Wissenschaft. Psychotherapie sei bei den meisten psychischen Erkrankungen allein oder in Kombination mit Psychopharmaka das Mittel der Wahl. Beispielsweise sei bei einer leitliniengerechten Behandlung von Depressionen aller Schweregrade Psychotherapie immer ein Behandlungsbestandteil.
Wenn es sinnvollerweise darum gehe, während der praktischen Tätigkeit Erfahrung im Umgang mit Patienten zu erwerben, müssten - so Munz - während des qualifizierenden Studiums ausreichende Grundkenntnisse und Grundkompetenzen zur Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen erworben werden. Diese Kompetenzen müssten formal abgeprüft und attestiert werden, sodass die rechtlichen Voraussetzungen für eine psychotherapeutische Tätigkeit unter Anleitung und Supervision erfüllt seien. Die anderen approbierten Heilberufe hätten hier unterschiedliche Lösungen gefunden. Beispielsweise erhielten Mediziner vor der Ausbildungsreform am Ende ihres Studiums zunächst eine befristete Berufsausübungsgenehmigung und erst nach dem damaligen (auch vergüteten) "Arzt im Praktikum" eine Approbation.
Natürlich wäre - hielt Munz fest - für Psychotherapeuten diese befristete Berufsausübungsgenehmigung nicht mit den gleichen Kompetenzen verbunden wie die derzeitige Approbation von PP und KJP. Voraussetzung für eine eigenverantwortliche psychotherapeutische Tätigkeit müsse daher auch künftig eine zweite Qualifizierungsphase sein - im Sinne der Weiterbildung bei den ärztlichen Kollegen. In dieser zweiten Qualifizierungsphase würden dann die Kenntnisse und Behandlungsfertigkeiten im Psychotherapieverfahren in vertiefter Theorieausbildung, Selbsterfahrung und Anwendung des Verfahrens unter Supervision erlernt. Erst der erfolgreiche Abschluss dieser zweiten Qualifizierungsphase ermögliche die eigenverantwortliche Ausübung von Psychotherapie, z. B. im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung oder in einer Leitungsfunktion im Krankenhaus.
In der anschließenden Diskussion wurden die Vorteile eines solchen Ausbildungsmodells für die Finanzierung von Ausbildungsteilnehmern während der praktischen Tätigkeit herausgestellt. Wenn sie qua Berufsausübungsgenehmigungen bereits über Kompetenzen zur Ausübung definierter Tätigkeiten verfügten, wäre eine Finanzierung dieser Tätigkeit einfacher durchzusetzen.
Gesundheitspolitische Prioritäten für die 17. Legislaturperiode
Das zweite zentrale Thema des 14. DPT war die Entwicklung einer gesundheitspolitischen Position für die 17. Legislaturperiode. Auch wenn man noch nicht wisse, wer die nächste Bundesregierung stelle, sei eins heute schon sicher: 2010 komme die nächste Gesundheitsreform, stellte BPtK-Präsident Richter fest.
Unter- und Fehlversorgung
Mindestens fünf Millionen Menschen leiden in Deutschland jährlich an einer schweren psychischen Krankheit und sind dringend psychotherapeutisch behandlungsbedürftig. Richter erläuterte, dass dazu ca. 700.000 Kinder unter 18 Jahren, ca. 2,9 Millionen psychisch kranke Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren und etwa 1,5 Millionen Menschen über 65 Jahren zählen. Psychotherapie allein oder in Kombination mit Pharmakotherapie sei unter Evidenzgesichtspunkten in den meisten Fällen das Mittel der Wahl. Diesem psychotherapeutischen Behandlungsbedarf stehen in Deutschland jedoch allerhöchstens 1,5 Millionen psychotherapeutische Behandlungsplätze im ambulanten und stationären Bereich gegenüber. Diese Zahl sei absichtlich überschätzt. Konsequenzen dieses Missverhältnisses seien lange Wartezeiten bei niedergelassenen Psychotherapeuten, zu wenig Psychotherapie in der stationären Versorgung und generell eine besorgniserregend hohe Verordnungsrate von Psychopharmaka. "Ärzte drohen mit Wartelisten für somatisch kranke Patienten. Wartelisten für psychisch kranke Menschen sind Versorgungsalltag", betonte Richter.
Sektorenübergreifende Bedarfsplanung
Richter erinnerte daran, dass mit dem GKV-OrgWG die Mindestquote für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in Höhe von 20 Prozent erreicht wurde. Dennoch habe sich die Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher bis heute nicht verbessert, da die Umsetzung des Gesetzes erst möglich sei, wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) bundeseinheitliche Regelungen in den Bedarfsplanungs-Richtlinien getroffen habe. Der G-BA jedoch lasse sich Zeit. Auch im Mai stehe die dringend notwendige Regelung nicht auf der Tagesordnung des G-BA-Plenums. Dies sei angesichts der Versorgungssituation Kinder und Jugendlicher schwer erträglich, erklärte Richter (vgl. Resolution "Bessere Versorgung für Kinder und Jugendliche nicht länger verzögern").
Richter wies noch einmal darauf hin, dass die Bedarfsplanung auf historischen Niederlassungsdaten der Psychotherapeuten basiert. Sie nehme damit den tatsächlichen Versorgungsbedarf nicht zur Kenntnis. Die Bedarfsplanung heutiger Prägung diene im Ergebnis der rigiden Einschränkung des psychotherapeutischen Angebots in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Niederlassungsmöglichkeiten hätten nichts mit dem nachweisbaren Bedarf an ambulanter Psychotherapie zu tun. De facto führe die Bedarfsplanung zur Rationierung psychotherapeutischer Leistungen im Kollektivvertragssystem.
Richter forderte, in der nächsten Legislaturperiode die Weichen für eine Bedarfsplanung zu stellen, die den realen Versorgungsbedarf auch unter sozioökonomischen und demografischen Aspekten erfasse. Darüber hinaus sollte die Bedarfsplanung sektorenübergreifend ausgerichtet werden, um auch die tagesklinische und ambulante Versorgung zu berücksichtigen, die immer stärker von Krankenhäusern geleistete werde. Und nicht zuletzt müsse die Bedarfsplanung dazu dienen, Versorgungslücken beim Nebeneinander von Kollektiv- und Selektivvertragssystem frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
Honorarreform 2009
Einen ersten Beitrag zur Verbesserung der Versorgung leiste die Honorarreform 2009. Richter erklärte, die Honorarreform 2009 bringe nicht nur eine bundesweit einheitliche, feste Vergütung pro Zeiteinheit, sondern schaffe auch Voraussetzungen für eine stärkere Versorgungsorientierung, da innerhalb der Kapazitätsgrenzen genehmigungspflichtige und nicht-genehmigungspflichtige Leistungen konvertierbar sind. Innerhalb der Kapazitätsgrenzen können Psychotherapeuten nun allein unter Versorgungsgesichtspunkten entscheiden, welche Leistungen sie erbringen wollen. Sie müssen nicht mehr befürchten, dass - wie in der Vergangenheit - die Honorierung der nicht-genehmigungspflichtigen Leistungen gegen Null tendiert. Psychotherapeuten können sich jetzt z. B. kurzfristig ein Bild vom akuten Versorgungsbedarf der Patienten auf ihrer Warteliste machen. Dies führe, so Richter, wie von einigen Kassenärztlichen Vereinigungen befürchtet, nicht zu einer ungesteuerten Mengenentwicklung, da die Behandlungszeit von Psychotherapeuten auf maximal 38 Stunden für Patienten der gesetzlichen Krankenversicherung je Woche begrenzt sei.
Der 14. DPT appellierte an die gemeinsame Selbstverwaltung von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen, die unter Versorgungsgesichtspunkten notwendigen und sachdienlichen Entscheidungen zur Honorarreform 2009 nicht wieder zurückzunehmen (vgl. Resolution "Psychotherapeutische Versorgung sicherstellen").
Morbiditätsorientierte Vergütung
Richter erinnerte daran, dass sich die Gesundheitspolitik beim GKV-WSG darin einig gewesen sei, dass die Gesamtvergütung - also das für die ambulante vertragsärztliche Versorgung zur Verfügung stehende Geld - die Morbiditätsentwicklung der Versicherten widerspiegeln solle. Dies könne für den somatischen Bereich gelingen. Für die Versorgung psychisch kranker Menschen sehe er jedoch große Probleme. Die Entwicklung der Morbidität werde für den vertragsärztlichen Bereich ab 2010 anhand ambulanter Diagnosen und des Behandlungsbedarfs geschätzt. Das dafür infrage kommende Klassifikationssystem könne jedoch den Versorgungsbedarf psychisch kranker Menschen nicht adäquat abbilden. Hauptursache sei, dass nur der Behandlungsbedarf der Patienten erfasst werden könne, die Zugang zum Versorgungssystem gefunden hätten. Nicht diagnostizierte, aber vor allem nicht behandelte Krankheiten - also alle Patienten auf Wartelisten - werden bei der Schätzung der Morbiditätsentwicklung unzureichend berücksichtigt. Der Behandlungsbedarf psychisch kranker Menschen werde deshalb strukturell unterschätzt - die Unterversorgung damit zementiert.
Die Klassifikationssysteme bauten zudem auf der de facto stattfindenden Versorgung auf. Sie seien blind u. a. für veränderte Behandlungskonzepte, wie sie z. B. in evidenzbasierten Leitlinien empfohlen werden. Richter regte eine Debatte um die Korrektur des § 87a Abs. 3 SGB V in der nächsten Gesundheitsreform an. Psychotherapeutische Leistungen müssten außerhalb der morbiditätsorientierten Gesamtvergütung honoriert werden. Dies sei möglich, da die antrags- und genehmigungspflichtigen Leistungen durch Gutachter geprüft würden und auf gesicherten Indikationen und Genehmigungen der Krankenkassen beruhten. Weitere psychotherapeutische Leistungen würden durch die Kontingente bzw. Kapazitätsgrenzen höchst effektiv in der Menge begrenzt. Eine zusätzliche Mengensteuerung sei damit absolut verzichtbar.
Differenzierung der psychotherapeutischen Versorgung
Die Profession werde - so Richter - verstärkt auf die massive Unterversorgung psychisch kranker Menschen hinweisen und eine Ausweitung der Behandlungskapazitäten einfordern. Nach seiner Einschätzung sei die Gesundheitspolitik aber nur bereit, mehr Geld für eine Ausweitung der Behandlungsressourcen zu geben, wenn es gelänge, die heutigen Behandlungskapazitäten effizient einzusetzen. Dieser Debatte müsse sich die Profession stellen. Es werde darum gehen, zentrale Fragen zu klären, z. B.: Wer erhält Psychotherapie? Wie kann sichergestellt werden, dass psychisch kranke Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht und sozialer Schicht Zugang zu Psychotherapie finden und welchen Beitrag könnte dazu die hausärztliche Versorgung leisten? Wie lasse sich der Direktzugang zur Psychotherapie weiter sichern? Von mindestens ebenso großer Relevanz sei die Frage, ob die knappe Behandlungsressource Psychotherapie ausreichend bedarfsorientiert eingesetzt werde. Müssten angesichts des Mangels nicht andere Behandlungssettings, also z. B. mehr Gruppen- statt Einzeltherapie, gefördert werden? Brauche man nicht eine flexiblere Handhabung des psychotherapeutischen Behandlungsangebots mit Blick auf Länge und Frequenz? Wie könnten Kriterien aussehen, um zu entscheiden, welche Patienten mit Angeboten zum Selbstmanagement und zur Selbsthilfe zurecht kommen, welchen mit einer qualitätsgesicherten psychosomatischen Grundversorgung geholfen wäre, wann es einer Einzel- oder einer Gruppentherapie im ambulanten Setting bedürfe und wann Patienten eine sektorenübergreifende Versorgung durch multiprofessionelle Teams bräuchten? Wie könne durch die Zusammenarbeit verschiedener Professionen eine qualitätsgesicherte und effiziente Versorgung organisiert werden, in die sich jede Profession mit ihren Kompetenzen einbringt?
Richter erinnerte daran, dass multiprofessionelle Kooperation funktioniere, wenn sie leitlinienbasiert konzipiert sei. Das geeignete Kooperationsmodell sei Teamarbeit mit definierten Kompetenzen und auf Augenhöhe. Hierarchische Strukturen, die leider immer noch von einzelnen Gesundheitsberufen gefordert bzw. verteidigt werden, seien der Sache nicht dienlich. Bessere Bedingungen für multiprofessionelle Kooperation sei eine weitere zentrale Forderung für die 17. Legislaturperiode. Es gehe darum, gemeinsam mit anderen Gesundheitsberufen die fachlichen Grundlagen zu schaffen und die notwendigen politischen Weichenstellungen möglichst präzise zu formulieren.
Vor diesem Hintergrund stellte BPtK-Präsident Richter die folgenden Forderungen für die nächste Legislaturperiode zur Diskussion:
- Das Kompetenzprofil der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erlaube ein breiteres Tätigkeitsspektrum als derzeit, z. B. im Krankenhausbereich, realisiert. Psychotherapeuten seien bestens qualifiziert, um z. B. Leitungsfunktionen in psychiatrischen Institutsambulanzen, Tageskliniken und psychotherapeutisch ausgerichteten Stationen bzw. Behandlungsteams zu übernehmen.
- In einem Medizinischen Versorgungszentrum, in dem Angehörige unterschiedlicher Gesundheitsberufe, die an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmen, tätig sind, sollte neben einer kooperativen Leitung auch die Leitung durch einen Psychologischen Psychotherapeuten oder Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten möglich sein (§ 95 Abs. 1 Satz 4 SGB V).
- In Vertragsarzt- bzw. Vertragspsychotherapeutenpraxen sollten Psychotherapeuten genauso wie Ärzte Arbeitgeber für die anderen an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmenden Berufsgruppen sein können (§ 95 Abs. 9 SGB V).
- Notwendig sei auch eine Relativierung des ärztlichen Verordnungs- und Überweisungsvorbehalts (§ 73 SGB V). Die Verordnung von Heilmitteln, wie z. B. Logopädie und Ergotherapie, die Bescheinigung der Arbeitsunfähigkeit sowie die Überweisung in ein Krankenhaus gehörten zum Kompetenzprofil der Psychotherapeuten. Zu prüfen sei auch, ob über entsprechende freiwillige, zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen Psychotherapeuten die Kompetenz zur Verordnung von Arzneimitteln erhalten sollten.
- Psychotherapeuten sollten sich genauso wie Vertragsärzte um eine präventiv ausgerichtete Gesundheitsversorgung bemühen können. Dazu bedürfe es einer Klarstellung, z. B. im Psychotherapeutengesetz und im § 73 SGB V.
Versorgungsforschung und Kodierqualität
Prof. Richter erinnerte daran, dass pragmatische Vorschläge und zielorientierte politische Weichenstellungen Erkenntnisse der Versorgungsforschung voraussetzten. Wie sieht es in der Versorgung wirklich aus? Stellen wir die richtigen Fragen? Was wirkt - was nicht? Versorgungsforschung werde die Routinedaten der Krankenhäuser, der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenkassen nutzen müssen. Dabei sei zu beachten, dass der Versorgungsbedarf - also die Morbidität der Versicherten - anhand der ambulanten und stationären Diagnosen beurteilt werde. Das Ausmaß von Unter- und Fehlversorgung, das jeder einzelne Psychotherapeut tagtäglich in der Praxis oder Klinik sehe, werde sich in den Daten der Versorgungsforschung nur widerspiegeln, wenn ausreichend dokumentiert werde, wie krank die Patienten sind. Er wisse, dass die Profession in der Vergangenheit sehr zurückhaltend mit diesem Thema umgegangen sei. Er sehe natürlich die Probleme der Stigmatisierung, des Datenschutzes und der fachlich begrenzten Aussagekraft von ICD-10-Diagnosen. Er sei aber auch davon überzeugt, dass die in der Vergangenheit hierzu eindeutig gegebene Antwort in der Zukunft wahrscheinlich nicht mehr tragfähig sei. Die Psychotherapeutenschaft müsse über eine Verbesserung bei der Kodierqualität nachdenken.
Zum Abschluss seiner Rede prognostizierte Prof. Richter eine sich intensivierende Debatte um die Priorisierung der Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Er appellierte an die Profession, es nicht den Ökonomen zu überlassen, zu bewerten oder gar zu entscheiden, welche Versorgung psychisch kranke Menschen brauchen. Heutzutage würden weder Häuser noch Straßen unter reinen Kostengesichtspunkten geplant und gebaut. Dort seien beispielsweise ökologische Vorgaben zu berücksichtigen, die einer Minimierung der Kosten Grenzen setzten. Entscheidungen der Gesundheitsversorgung dürften nicht ausschließlich unter Effizienzgesichtspunkten getroffen werden. So seien etwa die Umsetzung evidenzbasierter Leitlinien und die Berücksichtigung der besonderen Belange und Prioritäten psychisch kranker Menschen nicht verhandelbar.
Resolution BKA-Gesetz
Der 14. DPT befasste sich mit dem Gesetz zur Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus durch das Bundeskriminalamt (BKA). Seit Inkrafttreten dieses Gesetzes zum 1. Januar 2009 kann das BKA präventiv ohne konkreten Tatverdacht ermitteln. Zur Abwehr internationaler terroristischer Verbrechen kann es in die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre von Patienten und Psychotherapeuten eingreifen, ohne die Staatsanwaltschaft zu informieren. Das Zeugnisverweigerungsrecht von Psychotherapeuten wurde massiv beschnitten.
Der 14. DPT unterstützte mit einer Resolution die Verfassungsbeschwerde gegen das BKA-Gesetz und dankte Jürgen Hardt, Präsident der Hessischen Psychotherapeutenkammer, für seinen persönlichen Einsatz als einer der Beschwerdeführer. Gespräche zwischen Psychotherapeuten und ihren Patienten gehörten - so die Delegierten des Psychotherapeutentages - zum Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Dies sei nach Urteilen des Bundesverfassungsgerichts als ein letzter unantastbarer Bereich menschlicher Freiheit jeglichem staatlichen Einwirken entzogen. Psychotherapeutische Gespräche bedürften der absoluten Vertraulichkeit. Sie seien die Basis jeder professionellen therapeutischen Beziehung. Ein relativierter Vertrauensschutz schrecke Patienten von einer psychotherapeutischen Behandlung ab und gefährde deren Erfolg (vgl. Resolution "Deutscher Psychotherapeutentag unterstützt Verfassungsbeschwerde gegen BKA-Gesetz").
Zeitzeugenprojekt "10 Jahre Psychotherapeutengesetz"
"10 Jahre Psychotherapeutengesetz" nahm der Vorstand der BPtK zum Anlass, den Aufbau eines Archivs zur Entstehungsgeschichte, Umsetzung und Weiterentwicklung des Psychotherapeutengesetzes bei der BPtK anzukündigen. Es gehe im ersten Projektschritt darum, die schriftlichen Materialien all derjenigen zu sichern, die sich damals am Gesetzgebungsprozess beteiligt hätten. Darüber hinaus müsse man jetzt die Initiative ergreifen, um die Perspektive der Zeitzeugen durch Interviews zu dokumentieren. Ziel sei es, im BPtK-Archiv nicht nur die schriftliche, sondern auch die narrative Seite der Geschichte des Psychotherapeutengesetzes zu sichern.
Downloads
Veröffentlicht am 14. Mai 2009