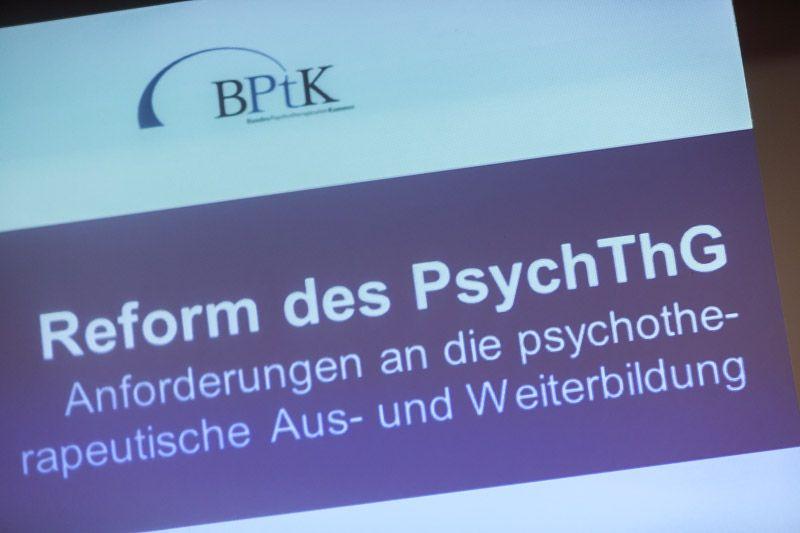Psychotherapeuten für die Versorgung qualifizieren
Anforderungen an ein Approbationsstudium und die anschließende Weiterbildung
Die Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) veranstaltete am 8. November 2016 ein Fachsymposium, um ihre Vorschläge zur Reform des Psychotherapeutengesetzes vorzustellen und zu diskutieren.
Eckpunkte des BMG für das Approbationsstudium
Annette Widmann-Mauz, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium (BMG), stellte in ihrem Grußwort erstmals Eckpunkte des BMG für ein psychotherapeutisches Approbationsstudium vor. Sie wies darauf hin, dass der Reformbedarf seit Jahren bekannt sei: die unklaren Zugangsvoraussetzungen durch die geänderten Studienstrukturen, der ungesicherte Status der Psychotherapeuten in Ausbildung (PiA) und die unzureichende Ausbildungsfinanzierung. Das BMG habe schon früh die Idee gehabt, diesen Problemen mit einer "Direktausbildung" zu begegnen. Mit dem Beschluss des 25. Deutschen Psychotherapeutentages (DPT) habe es dann das Signal gegeben, sich intensiver mit dieser Lösung zu befassen. "Ich weiß, wie in der Psychotherapeutenschaft um diese Position gerungen wurde, und danke für die Offenheit der Debatte der vergangenen Jahre", erklärte Widmann-Mauz. In der Folge des Beschlusses habe es Gespräche gegeben. Viele Vorschläge, unter anderem zu inhaltlichen Anforderungen an das Studium und zu Finanzierungsfragen, habe man erhalten und ausgewertet.
Die vielen Anregungen habe das BMG nun in den Eckpunkten zusammengeführt, mit denen die hohe Qualität der heutigen Ausbildung erhalten werden solle. "Die Eckpunkte sollen sowohl dem Beschluss des 25. DPT als auch den gesetzlichen Anforderungen gerecht werden." Das BMG sieht darin die Einführung einer zweiphasigen Qualifizierung von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten vor, mit einem wissenschaftlich und praktisch qualifizierenden Approbationsstudium, das alle Bezugswissenschaften der Psychotherapie umfasst, auf Masterniveau abschließt und über ein Staatsexamen zur Approbation führt. Daran schließt eine altersgruppenspezifische und verfahrensorientierte Weiterbildung an, die Voraussetzung für die Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung ist.
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, müsse die Ausbildung hinreichende wissenschaftliche und praktische Qualifikationen miteinander verbinden. Dazu gehörten Grundlagenwissen aus der Psychologie, Pädagogik und Medizin ebenso wie wissenschaftliche Kompetenzen zur Reflexion wissenschaftlicher Erkenntnisse und zur Weiterentwicklung der Psychotherapie. Theorie allein reiche aber nicht aus, es müssten praktische Erfahrungen hinzukommen. Psychotherapeut sei insbesondere ein praktischer Beruf und erfordere die Fähigkeit, professionell mit Patienten zu interagieren. Dazu müssten praktische Inhalte aus der heutigen Ausbildung in das Studium integriert werden. Damit werde zugleich die PiA-Problematik gelöst, weil Psychotherapeuten nach dem Studium mit der Approbation nicht mehr als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden könnten und einen gesicherten Rechtsstatus hätten. Zur Verteilung der theoretischen und praktischen Ausbildungsinhalte auf die beiden Studienabschnitte werde in den Eckpunkten ein erster Vorschlag gemacht.
"Ob hinreichende Fähigkeiten zur Ausübung der Heilkunde erworben wurden, können wir nur durch eine bundesweit einheitliche Prüfung feststellen. Wir werden daher auf ein Staatsexamen nicht verzichten. Daran halten wir als Voraussetzung für die Zulassung zum Beruf fest", stellte die Staatssekretärin klar. Jedoch wolle das BMG einen Rahmen schaffen, der auch eine Realisierung des Studiums in Einklang mit dem Bologna-Prozess ermögliche. Daher schlage man eine Kombination aus einem 3-jährigen ersten und einem 2-jährigen zweiten Studienabschnitt vor.
Die Staatssekretärin betonte, dass die Eckpunkte noch weiterentwickelt werden müssten. "Zu klären sind neben den Auswirkungen im Sozialversicherungsrecht auch Details der Organisation der Ausbildung sowie die Finanzierung der Aus- und Weiterbildung", so Widmann-Mauz. Wesentliche Fragen der Weiterbildung könnten aus Sicht des BMG erst diskutiert werden, wenn Klarheit über die Strukturen, Inhalte und die Finanzierung des Approbationsstudiums bestehe. Daher seien die Eckpunkte bereits mit Vertreterinnen und Vertretern der Kultus- und Gesundheitsministerkonferenz der Bundesländer diskutiert worden. Das BMG arbeite an einer zügigen Klärung der Reformdetails, um so bald wie möglich zu einem Arbeitsentwurf zu gelangen. Die Vorschläge der BPtK zur Organisation und Finanzierung der Weiterbildung werde man gerne für den weiteren Klärungsprozess nutzen.
Widmann-Mauz versicherte, dass die Weiterentwicklung der Eckpunkte gemeinsam mit der psychotherapeutischen Profession erfolgen werde. "Wir wollen keine Reform gegen Sie, sondern mit Ihnen gemeinsam". Bereits Ende November werde das Ministerium daher mit den psychotherapeutischen Fachverbänden und Fachgesellschaften, der Bundespsychotherapeutenkammer und der Hochschulseite sprechen. Auch mit der Ärzteschaft sei ein Gespräch geplant. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass in dieser Legislaturperiode kein Gesetzgebungsverfahren mehr zu erwarten sei. Ein Jahr sei dafür zu wenig. "Aber wir werden die verbleibende Zeit nutzen, damit es in der nächsten Legislaturperiode zügig ein parlamentarisches Verfahren geben kann", versprach Widmann-Mauz.
Reformbedarf und Lösungen der Profession
Dr. Dietrich Munz, Präsident der BPtK, stellte den grundlegenden Reformbedarf aus Sicht der Psychotherapeutenschaft dar. Das Psychotherapeutengesetz aus dem Jahr 1998 sei ein Meilenstein für die ambulante psychotherapeutische Versorgung in Deutschland gewesen. Damals seien mit den Psychologischen Psychotherapeuten und den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zwei neue approbierte Heilberufe geschaffen und in die Kassenärztlichen Vereinigungen integriert worden. Dadurch sei die ambulante Versorgung von Patienten wesentlich gestärkt worden.
Inzwischen sei der Reformbedarf jedoch groß und dringend. Die Bologna-Reform habe zu erheblichen föderalen Unterschieden bei den Zugangsvoraussetzungen zur psychotherapeutischen Ausbildung und damit bei der wissenschaftlichen Qualifizierung geführt. Damit sei die bundeseinheitliche Qualität der Ausbildung nicht mehr sichergestellt. Die finanziell prekäre und unklare rechtliche Situation der Psychotherapeuten in Ausbildung sei unzumutbar und führe teilweise zu einer sozialen Selektion. Schließlich hätten sich das Berufsbild der Psychotherapeuten sowie der Versorgungsbedarf massiv erweitert. Ohne eine grundsätzliche Ausbildungsreform könne man weder den aktuellen noch zukünftigen Herausforderungen aus der Versorgung gerecht werden.
Der 25. Deutsche Psychotherapeutentag habe sich daher 2014 für eine umfassende Reform ausgesprochen. Im Projekt Transition der BPtK würden seitdem mit breiter Beteiligung von Vertretern und Experten aus der Profession Reformvorschläge erarbeitet. Ein gemeinsames Berufsbild sowie detaillierte Vorschläge für die Novellierung des Psychotherapeutengesetzes und die Einführung einer Approbationsordnung seien bereits erarbeitet worden. Vorschläge für detaillierte Kompetenzziele für die Aus- und Weiterbildung sowie die Klärung von Strukturen für die Weiterbildung seien noch in Arbeit - jedoch ebenfalls schon weit fortgeschritten. Die BPtK habe Studien beim Essener Forschungsinstitut für Medizinmanagement (EsFoMed) sowie beim Deutschen Krankenhausinstitut (DKI) zur Organisation und Finanzierung der Weiterbildung in Auftrag gegeben.
"Wir sind schon weit gekommen", stellte Munz fest. Das BMG habe zentrale Aspekte des Berufsbildes übernommen. Er hob heraus, dass die Ausbildung nach den Eckpunkten auch für Leitungsfunktionen qualifizieren solle. "Damit teilt das BMG unsere Qualifikationsanforderungen für die Zukunft, die von anderen noch bestritten werden." Die größte Herausforderung sei allerdings noch die angemessene und nachhaltige Finanzierung der Weiterbildung. Die Eckpunkte seien für die Diskussion in der Psychotherapeutenschaft ein wichtiger Schritt. Nun brauche man weiter Offenheit und die Bereitschaft, Kompromisse zu finden.
Das psychotherapeutische Approbationsstudium – Vorschläge der Bundespsychotherapeutenkammer
Dr. Nikolaus Melcop, Vizepräsident der BPtK, skizzierte die im Projekt Transition erarbeiteten Vorschläge für das Approbationsstudium. Er wies darauf hin, dass viele grundlegenden Aspekte und auch Details gemeinsam in einer Koordinierungsgruppe mit Vertretern der Fakultätentage Psychologie und Erziehungswissenschaften sowie des Fachbereichstages Soziale Arbeit entwickelt worden seien, und dankte allen Beteiligten für ihr Engagement. "Diese gemeinsamen Positionen sind bei Diskussionen zur Weiterentwicklung der Eckpunkte des BMG unser Bezugspunkt", so Melcop. Neben den inhaltlichen und strukturellen Anforderungen an eine Approbationsordnung sei man sich darin einig, dass Hochschulen und Studierende eine ausreichende Flexibilität für unterschiedliche Schwerpunktsetzungen benötigten.
Gemeinsamer Leitgedanke sei, dass das Studium wissenschaftlich auf Masterniveau (Niveau 7 des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges Lernen - EQR) und praktisch für die eigenverantwortliche und selbstständige psychotherapeutische Tätigkeit qualifiziere. "Praxis und Wissenschaft sind die beiden Pfeiler, auf denen wir Psychotherapeuten ruhen", meinte Melcop. "Hier sind wir uns auch mit den Vertretern der Hochschulen einig." Dazu müsse sichergestellt werden, dass grundlegende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für eine umfassende Gesundheitsversorgung in allen Versorgungsbereichen und für alle Altersgruppen der Bevölkerung vermittelt würden. Man schlage dazu eine Studienstruktur vor, die auch die Integration von Bachelor- und Masterstudiengängen in einen ersten und zweiten Studienabschnitt zulasse. Um ein hinreichendes praktisches und wissenschaftliches Qualifikationsniveau zu ermöglichen, gehe die BPtK davon aus, dass eine Mindeststudienzeit von elf Semestern erforderlich sei. Das Studium sei im Vergleich zu anderen Bachelor-/Masterstudiengängen ein Semester länger konzipiert, da zur Vermittlung hinreichender Handlungskompetenzen ein Praxissemester am Ende des Studiums vorgesehen werde.
"Zu klären ist also, wie hinreichende praktische und wissenschaftliche Kompetenzen auch in einem Studium sichergestellt werden können", erläuterte Melcop mit Blick auf die Eckpunkte des BMG. Zudem seien bis zu einem Arbeitsentwurf für ein Gesetz die zu erwerbenden Kompetenzen für die Behandlung aller Altersgruppen und für die Versorgung in allen Versorgungsbereichen zu konkretisieren. Das BMG habe diesen Aspekt offenbar im Blick, er müsse sich aber auch in den verschriftlichten Details wiederfinden. Geplant werden müsse zum einen auch, wie eine ausreichende Anzahl an Studienplätzen sichergestellt werde.
Zum anderen müsse es aber auch Überlegungen dazu geben, wie diese Anzahl gegebenenfalls begrenzt werden könnte, um eine angemessene Relation zwischen Studienabgängern und dem Bedarf und Angebot an Weiterbildungsplätzen erreichen zu können.
Elaborierte Vorschläge für die Weiterentwicklung der Eckpunkte
In der Diskussion wurden die Eckpunkte des BMG zwar als später, aber konstruktiver erster Aufschlag für die Reform gewürdigt. Bedauern und Kritik wurde geäußert, dass es keine Verabschiedung des geplanten Gesetzes mehr in dieser Legislaturperiode geben soll. Viele zeigten sich positiv überrascht von dem erkennbaren Willen des BMG, die Vorschläge der Psychotherapeutenschaft und auch die teilweise verschiedenen Interessen von Psychotherapeuten, Psychotherapeuten in Ausbildung und Hochschulen sowie der Gesundheits- und Wissenschaftsressorts der Länder zu berücksichtigen.
Die vorgeschlagenen Ausbildungsziele seien wesentlich umfassender als heute und spiegelten die Vielfältigkeit der Psychotherapie und der Tätigkeiten von Psychotherapeuten wider. Die im Projekt Transition der BPtK entwickelten Vorschläge für eine Approbationsordnung hätten bereits eine hohe Detailtiefe erreicht und könnten für den weiteren Reformprozess als gute Grundlage dienen. Allerdings dürfe es nicht bei Regelungen für das Approbationsstudium bleiben. Auch die Finanzierung der Weiterbildung müsse gesetzlich mitgeregelt werden.
Praxisanteile für die selbstständige psychotherapeutische Tätigkeit
Hervorgehoben wurde die vom BMG angestrebte hohe Qualität der praktischen Ausbildung mit Patientenkontakt, Supervision, Selbstreflexion und Praktika in Einrichtungen der Versorgung. Damit werde deutlich, dass bereits in das Studium ausreichende Praxisanteile zu integrieren seien, damit eine Approbation erteilt werden könne. Zur Ausgestaltung der Praxisanteile wurden dann aber unterschiedliche Vorstellungen vorgetragen. Sie reichten von der Forderung nach praktischer Behandlungserfahrung in allen Grundorientierungen der Psychotherapie bis hin zu dem Vorschlag, den Schwerpunkt auch mit Blick auf die Studienkapazitäten auf die wissenschaftliche Qualifizierung zu legen und praktische Anteile auf die Weiterbildung nach dem Studium zu konzentrieren. Ein Approbationsstudium dürfe nicht überfrachtet werden, sondern müsse für die Studierenden auch machbar bleiben. Auch Ärzte verfügten mit ihrer Approbation noch nicht über praktische Erfahrungen des späteren Facharztgebietes.
Qualifikation auf Masterniveau
Die Qualifikation auf Masterniveau bzw. EQR 7 sei - so die einhellig vorgetragene Forderung - eine notwendige Voraussetzung für die Approbation in einem akademischen Heilberuf. Hierzu gab es eine Reihe kritischer Einwände zu den Eckpunkten des BMG. Es wurde bezweifelt, dass bei den hohen Praxisanteilen eine ausreichende wissenschaftliche Qualifizierung für einen Studienabschluss auf Masterniveau möglich sei. Die wissenschaftliche Qualifizierung sei im Gegensatz zur praktischen Ausbildung etwas, das nicht in der Weiterbildung nachgeholt werden könne. Dabei zeigte die Diskussion, dass konkret nachvollziehbar gemacht werden müsse, welcher Arbeitsaufwand mit welchen Studieninhalten verbunden sei. Die in den Heilberufegesetzen und dazugehörigen Approbationsordnungen immer noch verwendeten Stundenangaben müssten dazu in Maßeinheiten heutiger Studienprogramme umgerechnet und Ausbildungsinhalte in Kompetenzziele übersetzt werden. Daneben wurde auch die Auffassung vertreten, dass für die theoretische Ausbildung eine Definition kompetenzbasierter Ausbildungsziele genüge und Vorgaben für Stundenumfänge entbehrlich seien. Dies sei ein wichtiger nächster Klärungsschritt. Einzelne Teilnehmerinnen und Teilnehmer befürworteten hierzu auch eine Verringerung der Mindestanteile für die praktische Ausbildung bzw. deren Verlagerung in die Weiterbildung. Andere hielten eine 2 ½- bis 3-jährige Qualifizierung im 2. Studienabschnitt für notwendig.
Polyvalenter erster Studienabschnitt
Die Eckpunkte des BMG sehen erste klinisch-praktische Ausbildungsanteile bereits ab dem ersten Studienabschnitt vor. Dies widerspreche jedoch dem Ziel eines "polyvalenten" 1. Studienabschnitts, kritisierten insbesondere Vertreter der Studiengänge, die heute den Zugang zu den postgradualen Ausbildungen ermöglichen. Ein polyvalenter Bachelorabschluss sei aber die Voraussetzung, die heutigen Studiengänge für das Approbationsstudium zu nutzen, ohne das integrierte Angebot anderer Schwerpunkte in diesen Studiengängen unmöglich zu machen. Vor allem von Vertretern der Psychologie wurde die Gefahr gesehen, dass sich die Psychotherapeutenausbildung auf diese Weise von ihrer Kernwissenschaft entferne. Auch ließen die Eckpunkte damit offen, ob und wie eine Integration der pädagogischen bzw. erziehungswissenschaftlichen Hochschulausbildung realisiert werden könne. Zudem wurde von manchen bezweifelt, dass Studierende im Bachelorstudium aufgrund ihres Alters regelhaft schon über die persönliche Reife für die praktische Qualifizierung verfügen. Daneben sei auch zu klären, welche Berufsqualifikationen mit einem Bachelor- oder Masterabschluss in "Psychotherapie" verbunden wären. Vieles spreche dafür, den Bachelor nicht als speziellen Psychotherapiestudiengang auszugestalten, sondern mehreren Bachelorstudiengängen mit unterschiedlichen akademischen Bezeichnungen die Anerkennung als Approbationsstudiengang zu ermöglichen ("polyvalenter Bachelor").
Approbation für die Behandlung aller Altersgruppen
Der BMG-Vorschlag, die Berufe der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten zu einem Beruf, der für die Versorgung aller Altersgruppen qualifiziert, zusammenzuführen, wurde allgemein begrüßt. Allerdings seien in den Eckpunkten die Ausbildungsinhalte noch nicht so konkret, dass geprüft werden könne, ob das Approbationsstudium diesen Anspruch einlösen könne. In der Versorgung von Patienten der unterschiedlichen Altersgruppen bestünden wesentliche Unterschiede und Besonderheiten. Diese müssten sich in den Studieninhalten (theoretisch wie praktisch) niederschlagen. Wenn dies gelinge, könnten mit einem Approbationsstudium einheitlich hohe Qualifikationsstandards durchgesetzt werden. Ferner wurde die Sorge geäußert, dass es bei dem Ein-Berufe-Modell zu wenig Interessenten für eine Weiterbildung für Kinder und Jugendliche gebe und damit die Versorgung für diese Altersgruppe nicht mehr sichergestellt sei. Dem wurde entgegnet, dass es nach einer Befragung von Psychologiestudierenden ungefähr gleich viele Interessenten für das Gebiet Erwachsene und das Gebiet Kinder und Jugendliche gebe, vorausgesetzt, die jetzige Einschränkung des Behandlungsspektrums bestehe nicht mehr.
Breite der Psychotherapie
Sowohl in den Eckpunkten des BMG als auch in den Entwürfen der BPtK ist die praktische Ausbildung auf wissenschaftlich anerkannte Verfahren beschränkt. Vertreter von Psychotherapieverfahren, die vom Wissenschaftlichen Beirat Psychotherapie (noch) nicht anerkannt sind, sahen hierin eine unangemessene Einschränkung und forderten, alle Grundorientierungen der Psychotherapie im Studium so zu berücksichtigen, dass auch praktische Erfahrungen gesammelt werden. Auch müsse der Beruf für Neuentwicklungen offenbleiben.
Kompetenzen für die Versorgung in allen Versorgungsbereichen
Psychotherapeuten seien heute in sehr unterschiedlichen Versorgungsbereichen tätig. Um hier auch in Zukunft zum Zeitpunkt der Approbation ausreichende Kompetenzen sicherzustellen, sollten neben der ambulanten und stationären Versorgung bereits im Studium Kenntnisse für Tätigkeiten in Einrichtungen der komplementären Versorgung vermittelt werden, mahnten viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Psychotherapie habe zum Beispiel in Beratungsstellen, anderen Einrichtungen der Jugendhilfe, der Suchtberatung oder der Sozialpsychiatrie einen festen Platz. Daher sollte auch hier Weiterbildung möglich sein. Auch Querschnittskompetenzen aus den Gebieten Milieu, Familie und Gruppen seien nützlich. Dazu müsse nachgebessert werden, denn die Eckpunkte gingen darauf überhaupt noch nicht ein. Auch mit Blick auf die neuropsychologische Versorgung wies eine Teilnehmerin auf die Vermittlung weiterer naturwissenschaftlicher insbesondere biologischer Grundlagen hin, die für entsprechende Tätigkeiten im stationären Bereich bereits unmittelbar nach der Approbation erforderlich seien.
Legaldefinitionen: Gemeinsamer Beruf für ein breiteres Tätigkeitsfeld
Bedauert wurde, dass das BMG in den Eckpunkten noch keine Legaldefinition der Psychotherapie entworfen habe. Damit sei unklar, inwieweit eine mögliche Öffnung der Legaldefinition zur Einbindung von psychotherapeutischen Tätigkeiten in der Rehabilitation und Prävention und neuer Aufgaben und Befugnisse bereits mitbedacht werde.
Die BMG-Eckpunkte enthielten auch noch keine eindeutige Aussage zur Berufsbezeichnung. Deshalb warben einige Teilnehmer für eine gemeinsame Berufsbezeichnung "Psychotherapeutin" und "Psychotherapeut". Eine Bezeichnung "Psychologischer Psychotherapeut" sei insbesondere für Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten nicht tragbar und werde nicht allen Wurzeln und Bezugswissenschaften der Psychotherapie gerecht. Andere stellten die Vorzüge der Bezeichnung "Psychologischer Psychotherapeut" heraus, weil dieser auf die Kernkompetenz auch in Abgrenzung zur ärztlichen Psychotherapie abstelle.
Art der Hochschule
Das BMG fordert in seinen Eckpunkten ein Studium an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule. Das wurde von vielen begrüßt, da es damit die geltenden Zugangsvoraussetzungen der postgradualen Psychotherapeutenausbildungen für Absolventen der Psychologie übernehme. Nur auf diesem Weg könne eine ausreichende Strukturqualität, vor allem in der Forschung und der wissenschaftlichen Qualifizierung des Nachwuchses, sichergestellt werden.
Dem wurde jedoch entgegengehalten, dass dies nicht im Sinne der Bologna-Reform sei, nach der das geforderte Qualifikationsniveau EQR 7 auch mit einem Masterabschluss an einer Fachhochschule erreicht werden könne. Viele Hochschulen würden auf diese Weise rein formal ausgeschlossen, obwohl sie die inhaltlichen Anforderungen erfüllen könnten. Es wurde an den im Projekt Transition gefundenen Konsens erinnert, nach dem eine Hochschule das Promotionsrecht haben müsse, zur Ermöglichung von Promotionen jedoch auch mit einer anderen Hochschule kooperieren können solle. Um darüber hinaus sicherzustellen, dass an der Hochschule die notwendige Forschung betrieben werde, müsse auch eine Forschungsambulanz vorhanden sein.
Finanzierung der Studiengänge
Insbesondere Vertreter der psychologischen Studiengänge kritisierten die in den Eckpunkten vorgeschlagene Finanzierung, nach der neue Studiengänge vor allem durch Umschichtung von Personal aus anderen Bereichen der Psychologie in die Klinische Psychologie finanziert werden können. Es müsse geklärt werden, wie eine Finanzierung geregelt werden könne, die sowohl hinreichende Kapazitäten für die Weiterbildung sichere als auch den Bedarf an Kapazitäten der psychologischen Studiengänge berücksichtige.
GKV-Position die bessere Lösung?
Ein Beitrag plädierte für die Position des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-SV), weil nur auf diesem Weg der Status quo für die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie und die bisherigen Zugänge über pädagogische und psychologische Studiengänge erhalten blieben. Andernfalls gingen Psychologie und Pädagogik "den Bach runter".
Direkt zu diesem Vorschlag befragt, der nach dem Studium ein mehrjähriges "Referendariat" für die Qualifizierung in einem Richtlinienverfahren vorsieht, erläuterte BPtK-Präsident Dr. Munz, dass das GKV-Modell eine Beschränkung auf ambulante Versorgung und die heutige Richtlinienpsychotherapie vorsehe. Das werde weder dem heutigen noch dem zukünftigen Versorgungsbedarf auch nur annähernd gerecht. Zudem entspreche die vom GKV-Spitzenverband vorgeschlagene Fortführung der zwei Berufe Psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut nicht der inzwischen erzielten Einigung in der Profession, beide Berufe zu einem gemeinsamen Beruf zusammenzuführen und die Altersdifferenzierung erst in der zweiten Qualifikationsphase vorzusehen.
Perspektiven der Ärzte
Dr. Ulrich Clever, Vorstandsbeauftragter der Bundesärztekammer für Psychotherapie, signalisierte die Unterstützung der Bundesärztekammer für den Reformprozess. "Wir wollen Teil der Problemlösung sein", hob er hervor. Zugleich wies er darauf hin, dass Psychotherapie auch in der Ärzteschaft einen festen Platz habe. Er warb daher dafür, dass Psychotherapeuten und Ärzte auch künftig in einem gemeinsamen Wissenschaftlichen Beirat kooperieren, auch um die Einheit der Psychotherapie zu bewahren. Gleichzeitig appellierte er an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, dem Wunsch der Ärzteschaft nach einer klaren Abgrenzung der Berufe entgegenzukommen. Mit einer Berufsbezeichnung "Psychologischer Psychotherapeut" würden Bedenken in der Ärzteschaft entkräftet werden können.
Nach der Approbation: Weiterbilden für die Anforderungen der Versorgung
Wenn Psychotherapeuten am Ende des Studiums eine Approbation erhalten, bedeutet das nicht, dass sie bereits genügend Kompetenzen für die Erteilung einer Fachkunde haben - insbesondere für die eigenverantwortliche Behandlung von GKV-Patienten. Das erfordert einen weitergehenden Kompetenzerwerb in der anschließenden Weiterbildung. Dr. Andrea Benecke, Mitglied im BPtK-Vorstand, und Peter Lehndorfer, Vizepräsident der BPtK, stellten dazu die Eckpunkte einer künftigen Weiterbildung vor, die in den verschiedenen Arbeitsgruppen der BPtK unter Mitwirkung der Landespsychotherapeutenkammern, psychotherapeutischen Berufs- und Fachgesellschaften, Psychotherapeuten in Ausbildung und Verbänden von Ausbildungsinstituten erarbeitet wurden.
Ziel der Vorschläge sei es, die Breite der Kompetenzanforderungen aus der heutigen Versorgung in der Weiterbildung abzubilden: mit Spezialisierung in den Fachgebieten "Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen" oder "Psychotherapie mit Erwachsenen" und der Vertiefung eines Psychotherapieverfahrens zum Erwerb der verfahrensbezogenen Fachkompetenz. Um dabei das breite Spektrum psychotherapeutischer Tätigkeiten zur berücksichtigen, müsse es obligatorische Tätigkeiten in der ambulanten und in der stationären Versorgung geben. Darüber hinaus solle es möglich sein, Weiterbildungszeiten in weiteren psychotherapeutischen Arbeitsfeldern wie der Jugendhilfe, Suchthilfe oder Gemeindepsychiatrie zu absolvieren.
Die Kompetenzen sollten die künftigen Psychotherapeuten während einer mindestens fünf Jahre dauernden hauptberuflichen Tätigkeit erwerben. Die Dauer der Weiterbildung stelle sicher, dass ausreichende praktische Erfahrungen zu einem breiten Indikations- und Behandlungsspektrum gesammelt werden könnten, die lange und schwere Fälle miteinschließen, die Kompetenzerwerb für das Einzel- und das Gruppensetting und Erfahrungen in der berufsübergreifenden Kooperation und Tätigkeitsfeldern wie der Prävention und Rehabilitation ermöglichen würden. "Diese Zeitspanne bildet die Realität der heutigen postgradualen Ausbildung ab, die im Durchschnitt 4,7 Jahre dauert", erläuterte BPtK-Vorstand Benecke. Hauptberuflich bedeute nicht Vollzeittätigkeit, sodass parallel zur Weiterbildung auch eine wissenschaftliche Qualifizierung möglich sei und Familie und Beruf vereinbar seien.
Bei den Weiterbildungskapazitäten halte die BPtK 2.000 bis 2.500 Weiterbildungsplätze jährlich für erforderlich, um die aus Altersgründen aus der Versorgung ausscheidenden Psychotherapeuten ersetzen und den zusätzlichen Bedarf decken zu können, der mit dem breiteren Indikationsspektrum von Psychotherapie und mit dem erwarteten steigenden Personalbedarf in der stationären Versorgung wachse.
Zu den Anforderungen an die Koordinierung verschiedener Weiterbildungsinstitute und Inhalte erläuterte BPtK-Vizepräsident Peter Lehndorfer die verschiedenen Abhängigkeiten und rechtlichen Beziehungen zwischen den an der Weiterbildung beteiligten Personen, Organisationen und Institutionen. Dies erfordere bei der Qualifizierung von Psychotherapeuten - vor allem beim Erwerb der Fachkompetenz für ein Psychotherapieverfahren und in Bezug auf die Selbsterfahrung - einen besonderen Koordinierungsbedarf. Dieser könne durch übergreifende Weiterbildungscurricula und eine angemessene Verankerung der Weiterbildungsinstitute als Koordinatoren sichergestellt werden.
Neben der Organisation müsse aber auch die Finanzierung sichergestellt sein. "Psychotherapeuten in Weiterbildung beziehen ein Gehalt für ihre hauptberufliche Tätigkeit in ambulanten, stationären und komplementären Einrichtungen der psychotherapeutischen Versorgung", stellte Lehndorfer klar. "Daneben gibt es weitere Kostenstellen der Weiterbildung wie die Anleitung und Supervision inklusive der damit verbundenen Sachkosten, die Lehre zur Theorievermittlung und die Selbsterfahrung." Lehndorfer begrüßte, dass das BMG diese Finanzierungsfragen in einem Gesetzentwurf berücksichtigen wolle. Mit den in Auftrag gegebenen Expertisen werde die BPtK dazu konkrete eigene Vorschläge vorstellen. Ziel sei ein Gesetzentwurf, der die nachhaltige Finanzierung der Weiterbildung und die Umsetzung in den Weiterbildungsordnungen der Psychotherapeutenkammern ermögliche.
Modelle der Organisation und Finanzierung der ambulanten Weiterbildung
Prof. Dr. Jürgen Wasem und Dr. Anke Walendzik vom Essener Forschungsinstitut für Medizinmanagement stellten die Ergebnisse ihrer Expertise zur ambulanten psychotherapeutischen Weiterbildung vor, die die BPtK in Auftrag gegeben hatte. EsFoMed solle grundlegende Organisations- und Finanzierungsmodelle für die neu zu gestaltende ambulante psychotherapeutische Weiterbildung nach einem Approbationsstudiengang unter Berücksichtigung der Gestaltung der Kooperation mit den übrigen Bereichen der Weiterbildung entwickeln. Dazu befragte das Essener Institut zunächst Vertreter psychotherapeutischer Ausbildungsinstitute, psychotherapeutischer Verbände und Stakeholder in den Kassen- und Ärzteverbänden. Themen der Befragung waren die derzeitigen Kosten- und Ertragsstrukturen der Ausbildungsinstitute, die erwarteten Veränderungen durch eine Weiterbildung und mögliche Organisations- und Finanzierungsmodelle einer zukünftigen Weiterbildung. In einem zweiten Schritt entwickelte EsFoMed Kriterien zur Modellbewertung und hat diese in einem Workshop mit Vertretern der Profession validiert.
Organisationsmodelle
Prof. Wasem erläuterte zunächst drei mögliche Organisationsmodelle:
- ein "modulares Modell", bei dem sich Weiterbildungsteilnehmer Anbieter und Stätten für die geforderten Weiterbildungsteile selbst zusammenstellen können,
- ein "Koordinierungsmodell ambulante Weiterbildung", bei dem ein Weiterbildungsinstitut Lehre und Versorgungsleistungen einschließlich der zugehörigen Supervision und Selbsterfahrung während der ambulanten Weiterbildung koordiniert und
- ein "Koordinierungsmodell psychotherapeutische Weiterbildung", bei dem ein Weiterbildungsinstitut alle Teile der Weiterbildung koordiniert.
Vorteile des modularen Modells mit Auswahl der Weiterbildungselemente durch die Psychotherapeuten in Weiterbildung (PiW) seien hohe Wirtschaftlichkeitsanreize, Anpassbarkeit an verschiedene berufliche und private Konstellationen der PiW und eine mögliche große Vielfalt an Weiterbildungswegen. Nachteile seien mögliche Ineffektivitäten und Wartezeiten beim Übergang zwischen Weiterbildungsabschnitten, fehlende Verlässlichkeit für die PiW, schwache Koordination der Weiterbildung und Probleme der Kapazitätssteuerung.
"Die Vorteile der Koordinierungsmodelle, insbesondere des vollen Koordinierungsmodells, liegen in der starken Koordinationsleistung und der hohen Verlässlichkeit der Weiterbildung für die PiW", stellte Prof. Wasem fest. Eine hohe Weiterbildungsqualität sei wahrscheinlich und eine quantitative Steuerung wäre leichter zu realisieren als im modularen Modell.
Finanzierungsmodelle
Weitgehend unabhängig vom gewählten Organisationsmodell seien die möglichen Ansätze zur Finanzierung des Gehaltes von PiW und der Kostenblöcke der Weiterbildung, zu denen Honorarkosten für direkte Weiterbildungselemente (für Supervision, Selbsterfahrung und Lehre), Sachkosten (Raumkosten, Versicherungen usw.) sowie Personalkosten als Overhead (Geschäftsführung, Ambulanzleitung, Empfang und Verwaltung) zu zählen seien.
Diese Kostenblöcke würden heute durch Versorgungsleistungen der PiA und Gebühren der PiA finanziert. Würde man die Weiterbildung künftig alleine aus den Erträgen der durch PiW erbrachten Leistungen finanzieren, sei allenfalls eine anteilige Vergütung nach TVöD Entgeltgruppe 13 finanzierbar und auch das nur bei sehr günstigen Kostenstrukturen in großen Weiterbildungsstätten und nur bei dominierender Gruppenselbsterfahrung.
Grundgedanke eines weiteren Finanzierungsmodells sei daher ein GKV-Strukturzuschlag. Ein Teil der Weiterbildungskosten könnte so als notwendige Maßnahme zur Qualitätssicherung der von den PiW erbrachten Versorgungsleistungen finanziert werden. Zu diesen Leistungen könnten gehören: Supervisionsleistungen, Sachkosten sowie teilweise Refinanzierung des Ambulanzleiters. Aber auch auf diesem Wege wäre eine kostendeckende Finanzierung (einschließlich Lehre und Selbsterfahrung) nur bei geringster Vergütungsvariante der PiW in Verfahren mit vorwiegendem Angebot von Gruppenselbsterfahrung zu erreichen.
Veröffentlicht am 17. November 2016