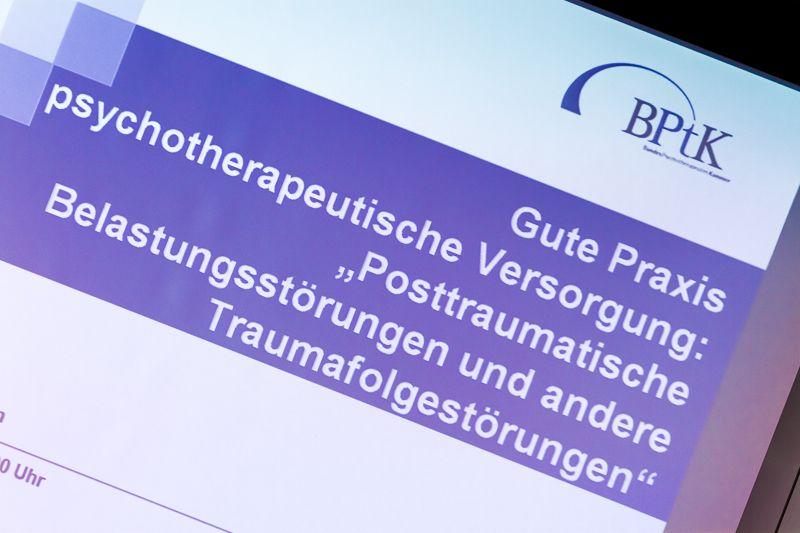Psychotherapie bei traumatisierten Patienten
Gute Praxis psychotherapeutische Versorgung: Posttraumatische Belastungsstörungen
Über Jahrzehnte wurde das Leiden von Opfern sexuellen Kindesmissbrauchs und Soldaten mit traumatischen Kriegserlebnissen von der Gesellschaft nicht oder nur unzureichend anerkannt. Notwendige Behandlungsangebote sind diesen schwer traumatisierten Patienten zum Teil bis heute nicht ausreichend zugänglich. Darauf wies Dr. Dietrich Munz, Vizepräsident der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK), auf der Veranstaltung zu Posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) am 5. Juni 2013 in Berlin hin.
Die Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung sind als Krankheitsphänomen schon seit über hundert Jahren bekannt. Dennoch dauerte es bis 1980, um die PTBS als eine selbstständige Diagnose erstmals anzuerkennen. Damals nahmen die US-Psychiater die Folgen schwerwiegender Traumatisierungen in ihre Klassifikation psychischer Erkrankungen (DSM-III) als eigene Kategorie auf.
Psychotherapie vorrangige Behandlungsmethode
Prof. Dr. Christine Knaevelsrud (Freie Universität Berlin) betonte in ihrem Vortrag zur S3-Leitlinie, dass die Konzeptualisierung der Diagnose PTBS noch immer gravierende Veränderungen erfahre. So werde international die Einführung der neuen Diagnose „Komplexe PTBS“ diskutiert (ICD-11). Darunter ließen sich Erkrankungen fassen, die nach jahrelangen oder wiederholten schweren traumatischen Erlebnissen, wie z. B. sexuellem Kindesmissbrauch, entstehen. Die Patienten litten nicht nur unter den klassischen PTBS-Symptomen, sondern auch unter einer anhaltenden Beeinträchtigung der Emotionsregulation mit affektiven Ausbrüchen und dissoziativen Zuständen, Störungen des Selbstkonzeptes und der Beziehungsgestaltung.
Traumatisierende Ereignisse, so Knaevelsrud, ließen sich einerseits danach unterscheiden, ob sie zufällig (akzidentiell) aufgetreten oder zwischenmenschlich verursacht seien. Anderseits sei wesentlich, ob die Ereignisse einmalig, unerwartet und mit akuter Lebensgefahr verbunden waren (Typ 1 Traumata) oder sie sich in einer andauernden Situation wiederholen, deren Verlauf nicht vorhersehbar ist (Typ 2 Traumata). Zwischenmenschliche Traumatisierungen gingen zwar mit einem höheren PTBS-Risiko einher, dennoch gebe es keine einfache Beziehung zwischen Art der Traumatisierung und Schwere der Beeinträchtigung. Auch die konkrete Ausprägung der Erkrankung lasse sich nicht zuverlässig aus der Art des traumatischen Ereignisses ableiten.
Die PTBS sei auch keineswegs die einzige psychische Erkrankung, die durch ein traumatisches Ereignis verursacht werden könne. Bei der aktuellen S3-Leitlinie habe jedoch die Diagnose „PTBS“ im Fokus gestanden, zu der es in der jüngeren Vergangenheit wichtige wissenschaftliche Weiterentwicklungen gegeben und die auch bei der Entstehung neuer Trauma-Ambulanzen und spezialisierter stationärer Angebote im Vordergrund gestanden habe. Dabei werde in den Leitlinienempfehlungen zugleich auf die besondere Notwendigkeit einer differenzialdiagnostischen Abklärung und die hohe Wahrscheinlichkeit komorbider psychischer Störungen hingewiesen. Die Leitlinie empfehle ferner, jedem PTBS-Erkrankten eine traumaspezifische Psychotherapie anzubieten. Nach aktuellen klinischen Studien würden bei einer traumafokussierten Psychotherapie etwa 80 Prozent der Patienten eine deutliche Besserung bzw. eine vollständige Remission der Symptomatik erreichen. Medikamente könnten zur Unterstützung der Symptomkontrolle indiziert sein, aber nicht als alleinige PTBS-Behandlung eingesetzt werden. Diese Empfehlungen seien mit einem starken Konsens von über 90 Prozent der Experten beschlossen worden.
Traumakonfrontation auch bei komplexer PTBS
Erste Therapiestudien hätten auch zeigen können, dass eine Besserung bei einer komplexen PTBS eine Konfrontation mit dem traumatischen Ereignis erfordert, auch wenn dieser in vielen Fällen eine intensivere Vorbereitung vorangehen müsse. Die Notwendigkeit einer Stabilisierungsphase sei in der Leitliniengruppe kontrovers diskutiert worden. Nur eine knappe Mehrheit der Experten habe sich für die entsprechende Empfehlung 5 ausgesprochen: „Manche Patienten mit PTBS haben eine unzureichende Affektregulation (z. B. mangelnde Impulskontrolle, dissoziative Symptome, Substanzmissbrauch, Selbstverletzungen, Suizidalität), die diagnostisch abgeklärt werden muss und initial in der Behandlungsplanung (individueller Stabilisierungsbedarf) zu berücksichtigen ist.“ Kritiker dieser Empfehlung hätten insbesondere die Gefahr gesehen, dass hierdurch die Rolle der Stabilisierungsphase in der Therapie der PTBS überbetont wird. So sei die psychotherapeutische Versorgung schon heute dadurch gekennzeichnet, dass indizierte traumakonfrontative Behandlungen häufig zugunsten einer ausgedehnten Stabilisierungsphase aufgeschoben würden oder gänzlich unterblieben.
Versorgungsstudien wiesen darauf hin, dass die Hürde für eine traumaspezifische, konfrontative Behandlung genommen werde, wenn die Behandelnden eine traumaspezifische Qualifikation erworben hätten. Vor diesem Hintergrund sei es anzustreben, dass die Integration der traumaspezifischen Techniken in die Psychotherapieverfahren weiter fortgesetzt und zugleich eine traumaspezifische Qualifikation in der Weiterbildung implementiert wird.
Zweiphasige stationäre Behandlung bei komplexer Traumatisierung
Sabine Drebes, Psychotherapeutin im Evangelischen Krankenhaus Bielefeld, stellte das stationäre Behandlungskonzept bei Traumafolgestörungen vor. Ganz überwiegend würden bei ihnen im Krankenhaus Patientinnen mit multipler Gewalterfahrung bzw. komplexer PTBS behandelt werden. Viele der behandelten Patientinnen litten u. a. unter einer ausgeprägten dissoziativen Symptomatik, die spezifisch therapiert werden müsse. Die Behandlung orientiere sich an der psychodynamischen imaginativen Traumatherapie (PITT) nach Luise Reddemann, die Phasen der Stabilisierung, Traumakonfrontation und Integration vorsehe. Der Schwerpunkt der Behandlung liege in der Einzel- und Gruppenpsychotherapie, die durch Stressbewältigung, Soziotherapie, kreative Therapie sowie Gespräche mit der Pflege unterstützt werde.
In der Behandlung kämen zunächst insbesondere imaginative Techniken zur Förderung der Selbstberuhigung und Selbstkontrolle zum Einsatz. Zugleich würden Ressourcen der Patientinnen identifiziert und ausgebaut. Zur Stabilisierungsphase gehören ferner die Wiederherstellung der Alltagsfunktionalität und die Therapie der dissoziativen Störungen und Symptome, die schließlich zu einem kontrollierten Umgang mit den traumatischen Erinnerungen führen solle. Neben Übungen, die die Ich-Funktion stärken, gehöre hierzu die Arbeit mit den verletzten inneren Anteilen, aber auch den verletzenden inneren Anteilen (Täterintrojekten).
Sei eine äußere Sicherheit (kein stark erhöhtes Risiko für weitere Traumatisierungen) sowie soziale, körperliche und psychische Stabilität (u. a. Affekttoleranz, Distanzierungsfähigkeit) erreicht, beginne die zweite Phase der Traumakonfrontation. Dafür werden, ähnlich wie bei der EMDR-Behandlung, das erste, das schlimmste und das letzte Trauma ausgewählt. Durch Umstrukturierung werde eine Integration der traumatischen Erinnerungen in ein ganzheitliches autobiografisches Bewusstsein angestrebt. Zum Einsatz kämen hierbei u. a. auch die Bildschirmtechnik und Techniken der EMDR-Behandlung.
Zum Abschluss der stationären Behandlung ginge es idealerweise um Trauerarbeit, Ressourcenstärkung für die Alltagsbewältigung, Zukunftsorientierung und Perspektivenentwicklung sowie die Überführung in das ambulante Setting.
Insbesondere aufgrund begrenzter Kostenübernahme durchliefen derzeit allerdings nur etwa 30 Prozent der Patienten während des Krankenhausaufenthaltes die Phase der Traumakonfrontation. Deshalb käme es zu teilweise vorab geplanten stationären Intervallbehandlungen, in denen dieser Teil der Traumabehandlung zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werde. Die Wiederaufnahmerate liege zurzeit bei circa 30 bis 40 Prozent.
Nach den bisherigen Evaluationsstudien zur stationären PITT-Behandlung profitierten die Patienten deutlich im Bereich der Depressivität und der Nutzung ihrer persönlichen Ressourcen im Alltag. Die Ergebnisse hinsichtlich der Verringerung der PTBS-spezifischen Symptomatik seien aber noch unbefriedigend. Hierzu werde derzeit eine weitere Evaluationsstudie durchgeführt.
Traumafokussiertes Arbeiten in der ambulanten Versorgung
Dr. Anne Boos, niedergelassene Psychotherapeutin, betonte in ihrem Vortrag, dass alle evidenzbasierten Psychotherapiemethoden konfrontative Behandlungselemente beinhalten. Das Traumagedächtnis werde insbesondere dadurch verändert, dass während der Emotionsverarbeitung neue Informationen in das Gedächtnis integriert werden. Hierbei kämen kognitive, behaviorale und imaginative Methoden zum Einsatz. Die konkrete psychotherapeutische Methode leite sich u. a. aus der jeweils vorherrschenden Emotion ab, z. B. sokratischer Dialog bei Schuldgefühlen. Im Verlauf der Behandlung würden in der Regel die verschiedenen traumaspezifischen Methoden – wie Konfrontation in vivo (Realität), Konfrontation in sensu (Vorstellung), Tatortbesichtigung, schriftliche Traumakonfrontation oder Triggerdiskrimination – miteinander kombiniert.
Wesentliche Hürden in der Behandlung seien vor allem ausgeprägte Dissoziationen, Selbstschädigung, interaktionelle Schwierigkeiten und eine schwere depressive Symptomatik. Daher könnten zwei Untergruppen von traumatisierten Patienten mit PTBS unterschieden werden:
• Patienten mit „einfacher“ Traumatisierung und eingeschränkter Komorbidität, die in der Regel zügig und massiert in einer Kurzzeittherapie bei günstiger Heilungsprognose traumafokussiert behandelt werden können,
• Patienten mit mehrfachen, schweren und frühen (meist sexuellen) Traumatisierungen und erheblicher psychischer Komorbidität.
Bei der zweiten Gruppe sei auch im ambulanten Bereich ein Zwei-Phasen-Modell sinnvoll, bei dem zunächst die Vermittlung von Skills, z. B. im Rahmen eines traumaspezifisch modifizierten DBT-Skilltrainings, im Vordergrund stehe. Da Stabilisierung die Voraussetzung, aber nicht die Therapie der PTBS sei, sollte die Traumabehandlung auch in der ambulanten Therapie frühzeitig zur Behandlungsoption gemacht werden. Werde eine langfristige Linderung oder Heilung der PTBS angestrebt, so sei die Konfrontationsbehandlung bei allen Traumapatienten die Methode der Wahl, auch bei Patienten mit komplexer PTBS, wie auch aktuelle Studien von Cloitre et al. (2010), Bohus (2013) und Steil (2010) gezeigt hätten.
Die zweiphasige Behandlung erfolge daher idealerweise aus einer Hand, auch um zu verhindern, dass die als schwierig erlebte Konfrontationsbehandlung in ein anderes Setting oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werde. Eine aktuelle Versorgungsstudie von Rosner (2010) zeige, dass nur 13 Prozent der Patienten mit PTBS in den vier Jahren nach einer stationären Behandlung, die inhaltlich auf eine Stabilisierung ausgerichtet war, auch tatsächlich eine traumafokussierte Therapie erhielten. Die traumaspezifischen Fortbildungscurricula für Psychotherapeuten seien daher wesentlich, um die therapeutenseitigen Barrieren für eine leitliniengerechte Behandlung von PTBS-Patienten in der ambulanten Versorgung in Zukunft weiter abzubauen.
Veröffentlicht am 29. August 2013