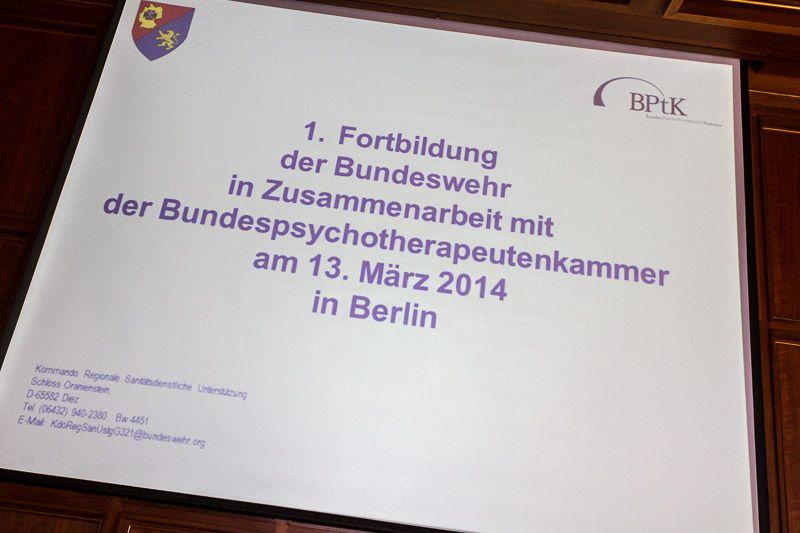Psychotherapeutische Versorgung von Soldaten
Erste Fortbildungsveranstaltung in Berlin
Am 13. März 2014 fand in der Blücher-Kaserne in Berlin-Kladow eine gemeinsame Fortbildungsveranstaltung der Bundeswehr und der Bundespsychotherapeutenkammer (BPtK) statt. Hintergrund der Veranstaltung ist eine Vereinbarung zwischen dem Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) und der BPtK zur ambulanten psychotherapeutischen Behandlung von Soldatinnen und Soldaten. Danach können sich zukünftig Soldaten nicht nur von Psychotherapeuten, die mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können, behandeln lassen, sondern auch von Psychotherapeuten mit Privatpraxis. Bundeswehr und BPtK vereinbarten gleichzeitig, regelmäßig gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen durchzuführen, in denen Psychotherapeuten Bundeswehrspezifika und das Verfahren der Behandlung und Abrechnung vorgestellt werden. In Berlin-Kladow fand die Pilotveranstaltung mit 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus dem gesamten Bundesgebiet statt. Weitere Fortbildungsveranstaltungen sollen folgen.
In seiner Begrüßung zitierte Oberstarzt Dr. Matthias Grüne das Sprichwort „Was lange währt, wird endlich gut“. Er spielte damit auf die lange Dauer der Vertragsverhandlungen zwischen Bundeswehr und BPtK an. Er betonte, dass er angesichts des Programms und des regen Interesses von Psychotherapeuten an der Fortbildungsveranstaltung davon ausgehe, dass sie ein Erfolg werde.
Prof. Dr. Rainer Richter, Präsident der BPtK, betonte in seinem Grußwort, dass sich die Kammer schon seit Langem für eine bessere psychotherapeutische Versorgung von Soldatinnen und Soldaten einsetze und der Vertrag dafür eine gute Grundlage sei. Der neue Bericht des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages vom Februar 2014 zeige, dass nach wie vor Verbesserungsbedarf bestehe.
Aus seiner Sicht gehe es bei der Veranstaltung darum, Psychotherapeuten „Feldkompetenz“ zu vermitteln. Psychotherapeuten müssten sich bei jeder Behandlung in die Lebenswelt ihrer Patienten hineinversetzen, die ihnen mehr oder weniger vertraut sei. Heute gehe es darum, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dem Feld „Bundeswehr“ vertraut zu machen. Prof. Richter verwies auf das große positive Echo auf den Vertrag in der Psychotherapeutenschaft, der die Verbesserung der Behandlung von Menschen mit Traumafolgeerkrankungen ein wichtiges Anliegen sei.
Und auch die Bundeswehr habe ihren Beitrag dazu geleistet. Er erinnerte an den Aufbau und die Arbeit des PsychoTraumaZentrums und die Einrichtung der Stelle eines Beauftragten für Posttraumatische Belastungsstörungen (PTBS).
Es sei ihm wichtig, daran zu erinnern, dass Psychotherapie in einem besonderen sozialen Raum stattfinde, der durch das besondere Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Psychotherapeut bestimmt ist. Dieses für den Erfolg einer Behandlung notwendige Vertrauensverhältnis müsse selbstverständlich auch bei der Behandlung von Bundeswehrangehörigen gesichert werden und werde auch gesichert. Das Ziel einer Psychotherapie werde dabei grundsätzlich vom Patienten soweit wie möglich im Konsens mit seinem Behandler bestimmt. Eine Behandlung an den persönlichen Wünschen des Psychotherapeuten zu orientieren, sei berufsrechtlich ebenso unzulässig, wie die Inhalte und Ziele von Dritten bestimmen zu lassen. Berufsordnung und Patientenrechtegesetz und damit insbesondere die Rechte des Patienten auf Selbstbestimmung, Aufklärung, Verschwiegenheit und Einsichtnahme gelten selbstverständlich auch für Behandlungen in institutionellem Kontext und damit auch für psychotherapeutische Behandlungen von Angehörigen der Bundeswehr. Die vereinzelt geäußerte Kritik an dem Anliegen von BPtK und Bundeswehr, behandlungsbedürftigen Soldatinnen und Soldaten schnell und angemessen zu helfen, zeuge von großer Unkenntnis dieser Rahmenbedingungen.
Die Moderatoren der Veranstaltung waren Oberstarzt Dr. med. Hansjörg Friedrich vom Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung und Regierungsdirektor Diplom-Psychologe Stefan Schanze vom Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr. Oberstarzt Friedrich stellte sich als „Projektoffizier“ für die Fortbildungsveranstaltungen vor. Regierungsdirektor Schanze war vor seiner jetzigen Tätigkeit vielfach als Truppenpsychologe in Auslandseinsätzen tätig.
Oberstleutnant Edgar Chatupa, Kommandeur des Lazarettregiments 31 „Berlin“, der Kommandeur des Standorts, führte in die Organisation der Bundeswehr und die Besonderheiten des Soldatenberufs ein. Er nahm Bezug auf Artikel 17a Grundgesetz, der Grundrechtsbeschränkungen im Wehrbereich regelt, sowie das Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz). Ausgehend von den verteidigungspolitischen Richtlinien schilderte er das Auftragsspektrum der Bundeswehr. Aufgabe sei heute nicht mehr nur die Landesverteidigung als Bündnisverteidigung im engeren Sinne, sondern eine Vielzahl weiterer Aufgaben. Dazu gehörten militärische Evakuierungsoperationen und nationales „Airpolicing“, also die Luftraumüberwachung, wie sie die Bundeswehr beispielsweise im Baltikum leiste. Aktuelles Beispiel seien die Awacs-Einsätze an der polnisch-ukrainischen Grenze.
Hauptmann Reiner Wottke, Kompaniechef 4./Lazarettregiment 31 „Berlin“, schilderte aus Sicht der Soldaten die Herausforderungen des Soldatenberufs allgemein und speziell im Einsatz. Zu Beginn ging er auf die Situation eines multinationalen Einsatzes ein und hob dabei seine Vorteile hervor. Er nannte insbesondere die Möglichkeit, spezialisiert, professionell, aufgabenorientiert, anpassungsfähig und ressourcenschonend Aufgaben zu übernehmen. Allerdings gebe es auch Nachteile. Es könne zu Schwierigkeiten kommen, insbesondere beim Teambuilding, beim Ausbildungsaufwand und den Unterschieden in Sprache und Kultur, die es zu berücksichtigen gebe. Ausgehend vom soldatischen Wertekanon schilderte er die Herausforderung für die Soldaten. Insgesamt seien derzeit knapp 5.000 Soldaten im Auslandseinsatz, davon die meisten in Afghanistan.
Hauptmann Wottke hob hervor, dass auch der Alltag in Deutschland eine besondere Belastung für die Soldaten sein könne. Einer der kritischen Punkte sei momentan die geforderte Mobilität und Flexibilität. Häufig komme es vor, dass Soldaten ihren Dienst auch im Inland hunderte von Kilometern von ihrer Heimat und ihrer Familie getrennt verrichten müssten. Dies belaste die Soldaten sehr, denn die wenigsten lebten allein, es gebe Ehepartner, Lebensgefährten, Kinder und immer häufiger auch betreuungsbedürftige Eltern. Längst nicht immer sei es möglich, sich mit anderen Soldaten über Auslandseinsätze oder Kriegserlebnisse auszutauschen. Vielmehr komme es nicht selten vor, dass ein Soldat nach einem Auslandseinsatz vor allem mit Soldaten seinen Dienst verrichte, die seine Erfahrungen bisher nicht gemacht hätten. Er sehe es als seine Aufgabe an, diese Soldaten zurück in die Mitte der Gemeinschaft zu holen. Allerdings gebe es durchaus eine Grundstimmung: „Psycho… brauch‘ ich nicht“.
Diplom-Psychologin Susan Thiele vom Einsatzführungskommando der Bundeswehr schilderte die aktuellen Einsatzgebiete und Einsatzsituationen der deutschen Soldaten. Aufträge des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr seien in erster Linie die nationale Einsatzplanung, die Einsatzführung und die Einsatzauswertung auf operativer Ebene. Die Operationszentrale des Einsatzführungskommandos sei jeden Tag im Jahr rund um die Uhr besetzt. Dies sichere den Informationsfluss und ermögliche Maßnahmen bei Sonderfällen. Die Hauptaufgabe von Truppenpsychologen im Einsatzführungskommando der Bundeswehr sei die Beratung des Befehlshabers und des Stabes. Ferner gehe es um die fachliche Führung der im Einsatz befindlichen Truppenpsychologen. Sie bereiteten die Einsätze vor und nach – jedenfalls soweit Klein- und Kleinstkontingente betroffen seien. Ferner unterstütze sie auch die Ansprechstelle der Bundeswehr für Hinterbliebene.
Thiele stellte auch die Dokumentation von belastenden Ereignissen vor, die formularmäßig erfasst werden. Der Disziplinarvorgesetzte entscheide – gegebenenfalls nach Beratung mit den Truppenpsychologen, ob ein Ereignis potenziell belastend sei und in die Dokumentation aufgenommen werde. Die Dokumentation könne insbesondere bei Wehrbeschädigungsverfahren zum Nachweis dafür herangezogen werden, dass ein bestimmtes Ereignis stattgefunden habe. Als einen besonderen Aspekt schilderte sie die Möglichkeit, auf Wunsch von Hinterbliebenen den versehrten Leichnam eines Soldaten so zu behandeln, dass für Angehörige ein Abschied in Deutschland möglich sei. Außerdem ermögliche die Ansprechstelle für Hinterbliebene in Einzelfällen auch Reisen in das Einsatzgebiet, um dort Abschied zu nehmen, wo der Soldat gefallen sei. Dabei ging sie auf das Projekt Weitererinnerung und den Ehrenhain der Bundeswehr ein. Das Ziel sei es, die verschiedenen Gedenkstätten an den Einsatzorten der Bundeswehr abzubauen und in der Kaserne am Schwielowsee in einem Wald der Erinnerung erneut aufzubauen. So solle ein zentraler Ort der Erinnerung für Hinterbliebene, aber auch allgemein ein Ort des Gedenkens entstehen. Dieser solle der Öffentlichkeit erstmals am Tag vor dem Volkstrauertag, am 15. November 2014, zugänglich sein.
Danach beschrieb Susan Thiele die Arbeit des Truppenpsychologen. Truppenpsychologen waren erstmals 1993 beim Einsatz der Bundeswehr in Somalia dabei. Ihre drei Hauptaufgaben seien die Führungsberatung, die Einzelfallberatung von Soldaten und die psychologische Krisenintervention. Zu den Belastungsfaktoren im Einsatz gehörten die Trennung von nahestehenden Personen, die Erfahrung von großen Kulturunterschieden, ungewohnte klimatische Bedingungen, Stress, das Fehlen von Privatsphäre im Lagerleben sowie lebensbedrohliche Situationen bei Kriegseinsätzen.
Regierungsrat Diplom-Psychologe Alexander Varn, leitender Truppenpsychologe beim Kommando Sanitätsdienstliche Einsatzunterstützung, beschrieb seine persönlichen Erfahrungen im Einsatz. Zu den „regulären“ Stressoren, denen der Soldat zu Hause ausgesetzt sei, kämen spezifische Stressoren im Einsatz hinzu. So könne es zu Hause familiäre, soziale, wirtschaftliche und andere Belastungen geben. Im Einsatz sei der Soldat dann Trennung von Zuhause, Bedrohung, Gewalt und auch Zerstörung ausgesetzt. Aber auch ohne extreme Situationen sei die Belastung im Einsatz oftmals sehr hoch. Dazu könne etwa auch der dauernde Lärm von Generatoren direkt neben den Unterkünften gehören. Ein erheblicher Belastungsfaktor könne auch die Langeweile sein, etwa wenn Einheiten, die für den Ernstfall vor Ort seien, unterfordert seien, weil nichts passiere.
Auch Varn nannte wie Thiele drei Kernaufgaben für die Truppenpsychologie: die Führungsberatung für Vorgesetzte, die Einzelfallberatung für alle Soldaten und die psychologische Krisenintervention nach kritischen Ereignissen. Jeder Soldat habe die Möglichkeit, sich ohne Einhaltung des Dienstweges bei dienstlichen und privaten Problemstellungen an die Truppenpsychologen zu wenden, die der beruflichen Schweigepflicht unterliegen. Die Truppenpsychologen seien allerdings nicht kurativ tätig.
Am Ende eines Einsatzes gebe es vor Ort Gespräche über die Rückkehr sowie eine truppenärztliche Untersuchung mit einem Screening. Ebenso seien sechs bis acht Wochen nach dem Einsatz Nachbereitungsseminare vorgesehen. Bei Bedarf gebe es auch die Möglichkeit einer Präventivkur. Dies sei dann auch der Zeitpunkt, an dem Soldaten möglicherweise die Hilfe eines Psychotherapeuten in Anspruch nähmen.
Nach der Mittagspause schilderte Regierungsdirektor Schanze vom Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung seine eigenen Erfahrungen während eines Einsatzes in Afghanistan. Er berichtete, wie in einem Konvoi ein Fahrzeug von der Straße abgekommen und im Graben steckengeblieben sei. Es habe in diesem Fall eine Stunde gedauert, bis das Fahrzeug wieder auf die Straße verbracht werden konnte. In dieser Zeit seien die Soldaten fast schutzlos möglichen Anschlägen ausgeliefert gewesen. Weiterhin beschrieb er, dass Soldaten an Dorfversammlungen teilnehmen und dabei unbewaffnet und ohne Schutz durch Helm und Westen seien.
Schanze stellte die Ergebnisse der Prävalenzstudie zu Posttraumatischen Belastungsstörungen der Technischen Universität Dresden vor, die unter der Leitung von Prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen durchgeführt worden war. Demnach erkranken zwischen 1,8 und 2,9 Prozent der Soldaten während eines Einsatzes an einer PTBS. Dies sei ein geringerer Prozentsatz als vermutet. In anderen Studien seien bisher erheblich höhere Erkrankungsraten festgestellt worden. Die vergleichsweise niedrige deutsche PTBS-Rate sei zum Beispiel im Vergleich zu amerikanischen Streitkräften aber erklärbar. Amerikanische Streitkräfte seien im Irak und in Afghanistan viel häufiger in Kampfeinsätze verwickelt. Aber auch eine intensivere Einsatzvorbereitung, eine kürzere durchschnittliche Einsatzdauer und eine strengere Handhabung der PTBS-Kriterien seien Faktoren, die zu unterschiedlichen Erkrankungsraten führten. Auslandseinsätze erhöhten aber nicht nur das Risiko einer PTBS, sondern auch das Risiko anderer psychischer Erkrankungen.
Schanze stellte das Rahmenkonzept „Erhalt und Steigerung der psychischen Fitness von Soldatinnen und Soldaten“ vor. Die Bezeichnung „psychische Fitness“ sei kein wissenschaftlich fundierter Begriff, sondern eine Wortschöpfung des BMVg in Parallele zur „physischen Fitness“, die allgemein bekannt sei und unter der sich jeder Soldat etwas vorstellen könne. Die Analogie solle dazu beitragen, dass Fragen der psychischen Gesundheit und Erkrankung bei Soldaten stärker beachtet werden. Ein Screening der psychischen Fitness erfolge mittels Test- und Fragebögen sowie persönlichen Gesprächen vor dem ersten Einsatz, nach jedem Einsatz und ohne Einsatz alle drei Jahre. Ergäben sich dabei Auffälligkeiten, könne bei Empfehlung durch den Truppenpsychologen das Programm PAUSE (Psychologische Maßnahmen zum Ausgleich psychoreaktiver Einsatzfolgen) eingesetzt werden, das etwa zwei Wochen dauere, von einem Psychologen geleitet werde und in ausgewählten Einrichtungen stattfinde. Der Probebetrieb sei ab Mitte 2014 geplant. Auch gebe es Seminare von fünf Tagen Dauer, mit denen ein Einsatz nachbereitet werde. Diese seien für Einsatzgeschädigte, die therapiert oder stabil seien, sowie deren Angehörige oder Hinterbliebene gedacht. Schließlich stellte er die Trainingsplattform CHARLY (Chaos driven Situations Management retrieval System) vor, mit der Soldaten auf Einsätze vorbereitet würden. Hierbei handele es sich um ein Computerprogramm, das dem Soldaten einsatzspezifische Situationen simuliere und seine Selbstberuhigungsmöglichkeiten stärke.
Schanze erläuterte, dass die Bundeswehr mit 245 Wehrpsychologen plane, davon etwa 110 beim Personalmanagement. Die Übrigen verteilten sich über Streitkräfte, Basis, Heer, Luftwaffe, Sanitätsdienst und Marine. Dabei sei wichtig, dass der Truppenpsychologe nicht wie der Truppenarzt eine präklinische medizinische Versorgung durchführe. Er sei rein präventiv tätig.
Diplom-Psychologin und Diplom-Theologin Rita Quasten, Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung, befasste sich mit dem Psychosozialen Netzwerk (PSN) der Bundeswehr, zu dem der psychologische Dienst der Bundeswehr, der Sanitätsdienst, der Sozialdienst, aber auch die katholische und evangelische Militärseelsorge gehörten. Das Netzwerk biete die therapiebegleitenden Maßnahmen, auf die Soldaten oder ihre Angehörigen bei der Bundeswehr zugreifen könnten. Quasten stellte klar, dass Soldaten keine freie Arztwahl haben. Vielmehr erfolge die Versorgung der Soldaten über den Truppenarzt. Dieser entscheide, ob ein Soldat auf weitere Fachärzte zugreifen könne.
Beim Sozialdienst handele es sich um eine professionelle und kostenlose Dienstleistung der Wehrverwaltung für Soldaten und ihre Bezugspersonen. Ziel sei die Hilfe bei sozialen, familiären, persönlichen, materiellen und rechtlichen Problemen. Der Sozialdienst sei flächendeckend in Deutschland bei den Dienstleistungszentren der Bundeswehr angesiedelt. Dessen Aufgaben unterteilen sich in die Bereiche Sozialarbeit und Sozialberatung. Bei der Sozialarbeit gehe es um Hilfe bei sozialen, familiären und persönlichen Problemen. Die Sozialberatung hingegen befasse sich mit materiellen und rechtlichen Problemen und informiere Soldaten darüber, wie sie materielle Ansprüche durchsetzen könnten.
Die Militärseelsorge bestehe aus etwa 90 katholischen und 100 evangelischen Hauptamtlichen. Diese beraten die Truppenführer in religiösen und ethischen Fragen und seien auch Mittler zu den Religionsgemeinschaften im Einsatzland. Daneben geben sie lebenskundlichen Unterricht zur ethischen und moralischen Orientierung der Soldaten.
Quasten veranschaulichte die Verteilung der Ansprechstellen des PSN der Bundeswehr. Sie wies darauf hin, dass jeder Soldat ohne Schwierigkeiten herausfinden könne, wer sein Ansprechpartner sei. Sie empfahl, Soldaten auf die Arbeit des PSN hinzuweisen und sie zu ermuntern, gegebenenfalls auch dessen Angebote in Anspruch zu nehmen. Wichtigstes Ziel des PSN sei die Stressbewältigung sowie das Erkennen, Vermeiden oder Kompensieren psychischer Belastungsreaktionen. Das PSN diene dazu, die Betroffenen seelisch zu stabilisieren, Lösungswege aufzuzeigen und die Problemlösekompetenzen wiederherzustellen. Alle Angehörigen des PSN seien zur Verschwiegenheit verpflichtet. Eine Informationsweitergabe ohne Zustimmung der Betroffenen erfolge weder innerhalb noch außerhalb des PSN. Auch im Einsatz könnten Soldatinnen und Soldaten auf das PSN zurückgreifen, denn Truppenärzte, Truppenpsychologen und Militärseelsorge gingen auch mit in die Auslandseinsätze. Das PSN werde ergänzt durch eine zentrale Hotline im Bundeswehrkrankenhaus Berlin, die Seite www.ptbs-hilfe.de sowie das Netzwerk der Hilfen im Internet unter www.bundeswehr-support.de.
Regierungsdirektorin Christina Alliger-Horn, Leitende Psychologische Psychotherapeutin im Bundeswehrkrankenhaus Berlin, referierte zum Thema „Trauma und Traumafolgestörungen – Behandlungen in der Bundeswehr und Schnittstellen zum zivilen Bereich“. Nach der PTBS-Studie der Technischen Universität Dresden hätten über 80 Prozent der Soldaten bei Auslandseinsätzen zerstörte Häuser und Dörfer gesehen und mehr als die Hälfte seien Feindseligkeit der Zivilbevölkerung ausgesetzt gewesen. Ein Drittel sei angegriffen oder überfallen worden, ein knappes Drittel habe in vermintem Gelände gearbeitet, knapp 30 Prozent seien mit Handfeuerwaffen angegriffen worden, über 28 Prozent hätten Leichen oder Leichenteile gesehen und mehr als ein Fünftel habe tote oder schwer verletzte Kameraden erlebt und immer noch über ein Fünftel sei bei einem Angriff knapp verfehlt worden.
Obwohl also erhebliche Belastungsfaktoren vorlägen, gaben fast drei Viertel der Soldaten in der PTBS-Studie an, allein mit ihren Problemen fertigwerden zu wollen. Über 30 Prozent vermuteten, dass eine Behandlung nicht helfen würde. 15 Prozent schilderte Probleme mit Fragen wie Anfahrt und Zeitplanung der Behandlung. Gut fünf Prozent hätten keinen Behandler oder Therapeuten gefunden.
Alliger-Horn schilderte die Standards der Psychodiagnostik im Bundeswehrkrankenhaus und die dort stattfindende Behandlung. Anschaulich beschrieb sie, womit ein ambulanter Psychotherapeut rechnen müsse, und ging dabei auf die Besonderheiten von soldatischen Patienten ein. Aus ihrer Sicht spielten Scham und Angst vor Stigmatisierung eine zentrale Rolle. Auch gebe es nicht selten ein „Misstrauen“ gegenüber zivilen Strukturen. Von Vorteil sei hingegen, dass die überwiegende Zahl der Patienten eine stabile „Ich-Struktur“ aufweise. Außerdem seien militärische Strukturen, Regeln und Kameradschaft wichtige Ressourcen, auf die eine Behandlung aufbauen könne. Die guten Unterstützungsangebote durch das PSN seien sehr hilfreich bei der Behandlung von Soldaten. Selten gebe es allerdings „reine“ PTBS-Patienten, fast immer lägen Komorbiditäten vor.
Anschließend hielt der PTBS-Beauftragte der Bundeswehr, Brigadegeneral Klaus von Heimendahl, sein verspätetes Grußwort. Heimendahl stieß erst nachmittags zu der gemeinsamen Tagung, da er von einem Gespräch mit Bundesverteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen kam, die sich zwei Stunden lang Zeit genommen hatte, um sich über PTBS bei Soldaten zu informieren. Wichtig sei ihm, sagte der Brigadegeneral, dass er kein reiner PTBS-Beauftragter sei, sondern ein Ombudsmann für alle Einsatzverwundeten. Aufgrund der besonderen Bedeutung von PTBS in der öffentlichen Wahrnehmung habe man sich jedoch entschieden, dies in der Amtsbezeichnung besonders hervorzuheben. Die volle Bezeichnung laute: „Beauftragter des Verteidigungsministeriums für einsatzbedingte posttraumatische Belastungsstörungen und Einsatzgeschädigte“. Er habe im Wesentlichen zwei Aufgaben für Soldaten: die Information und die Beratung. Er selbst habe keinen medizinischen Hintergrund, wenn man davon absehe, dass er Pädagogik mit Schwerpunkt Psychologie studiert habe. Er komme aus der Praxis und verfüge auch über Einsatzerfahrung.
Aus seiner Sicht sei die stationäre Versorgung von Soldaten gut. Allerdings müsse man sich im Rahmen der ambulanten Versorgung in der Fläche besser aufstellen. Das große Interesse an dieser gemeinsamen Veranstaltung mit der BPtK zeige, dass dies gelingen könne. Schwierig für die Soldaten sei es, dass ihre Aufgaben bei Auslandseinsätzen in der Öffentlichkeit sehr kontrovers diskutiert würden. Man solle bedenken, dass Soldaten keine Wahl hätten. Wenn sie den Befehl erhielten, müssten sie in den Einsatz. Die Unterstützung durch die Bevölkerung sei sehr wichtig, denn die Soldaten würden in einen Auslandseinsatz geschickt, der vom Deutschen Bundestag beschlossen worden sei. Er setze sich dafür ein, dass psychisch verletzte Soldatinnen und Soldaten gut versorgt werden. Viele hätten ihm jedoch berichtet, dass manche Behandler nur sehr wenig über die Bundeswehr wüssten. Dieses Seminar sei ein sehr guter Einstieg, dies zu ändern.
Im Anschluss an den PTBS-Beauftragten der Bundeswehr richtete der Leiter des Psychologischen Dienstes der Bundeswehr, Ministerialrat Diplom-Psychologe Günter Kreim, einige Worte an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der gemeinsamen Tagung. Der Psychologische Dienst der Bundeswehr sei inzwischen etabliert. 20 Psychologische Psychotherapeuten arbeiteten im Rahmen der stationären Behandlung von Soldaten. Auch die anderen psychologischen Felder seien vom Psychologischen Dienst abgedeckt. Er selbst komme gerade von einem Seminar für Angehörige, das für die Dauer einer Woche in Oberwiesental stattgefunden habe. In diesem und anderem Kontext habe er festgestellt, dass zwar häufig etwas hätte getan werden können, aber niemand für eine psychotherapeutische Behandlung gefunden worden sei.
Eine Besonderheit bei der Behandlung von Soldaten sei es, dass viele Symptome, die eine zentrale Rolle bei der Diagnose einer PTBS spielten, bei Soldaten gewollt und notwendig für ihre Tätigkeit im Einsatz seien. So sei eine hohe Sensibilität für Ereignisse gerade wichtig, um im Einsatz Gefahren zu erkennen und sie zu vermeiden. Abschließend ging er auf die Überarbeitung der Ethikrichtlinien des Berufsverbandes Deutscher Psychologen ein.
Oberfeldarzt Dr. med. Bernd Röhrich vom Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung schilderte in seinem Vortrag „Heilbehandlung für die Bundeswehr: Beantragung – Verlängerung – Abrechnung“ das Verfahren bei der Behandlung von Soldaten. Er wies dabei zunächst auf die Besonderheiten der Stellung des Soldaten hin. Zentral für ihn sei der Truppenarzt, der immer aufzusuchen sei. Daneben gebe es den Wehrpsychiater, der bei fachlichen Fragen hinzugezogen werden könne, sowie das Kommando Regionale Sanitätsdienstliche Unterstützung, das für die Heilfürsorge zuständig sei, und das Bundesamt für Personalwesen in der Bundeswehr, das die Abrechnung vornehme.
Komme eine Psychotherapie in Betracht, so suche sich der Soldat einen Psychotherapeuten und der Truppenarzt händige ihm ein Formular aus, das die Genehmigung von zunächst fünf probatorischen Sitzungen beinhalte. Weitere Stellen würden in diesem Stadium nicht beteiligt. Die probatorischen Sitzungen rechne der Psychotherapeut unmittelbar mit dem Bundesamt für Personalwesen in der Bundeswehr ab oder bei Kassenzulassung über die Kassenärztliche Vereinigung. Komme er zu dem Ergebnis, dass eine Kurzzeittherapie notwendig sei, so nutze er entweder die vertragsärztlichen Formulare oder schreibe einen kurzen Konsiliarbericht an den Truppenarzt, der dann bis zu 25 Therapieeinheiten genehmige. Der Truppenarzt könne dabei auch den Wehrpsychiater der Bundeswehr hinzuziehen.
Werde die Kurzzeittherapie später in eine Langzeittherapie umgewandelt, so erfordere dies einen Bericht an den Gutachter. Als Gutachter fungiere in diesem Fall der Wehrpsychiater der Bundeswehr. Da der Wehrpsychiater nicht immer zeitnah hinzugezogen werden könne, könne es vorkommen, dass auch bei der Beantragung einer Langzeittherapie zunächst eine Kurzzeittherapie genehmigt werde und die Genehmigung weiterer Sitzungen danach erfolge. Bei analytischer Psychotherapie müsse ebenfalls von Beginn an ein Antrag mit Bericht an den Gutachter übermittelt werden.
Nach der Behandlung könne abgerechnet werden. Vertragspsychotherapeuten rechneten unter Zuhilfenahme des übermittelten Formblattes des SanBW 0217 und dem Behandlungsausweis über ihre Kassenärztliche Vereinigung ab. Therapeuten ohne Kassenzulassung nutzten das Formblatt SanBW 0218 und das Genehmigungsschreiben, mit dem die Psychotherapie genehmigt wurde. Zur Abrechnung übersende man die entsprechenden Unterlagen an das Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr.
Veröffentlicht am 21. März 2014